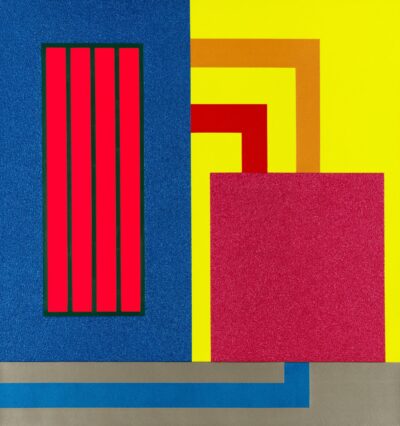„Ich hatte meinen Traumjob“
Nach 17 Jahren an der Spitze der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) verabschiedet sich Hermann Parzinger in den Ruhestand. Wir sprachen mit ihm über sein Elternhaus, den Weg zur Archäologie, die Schwachstellen des Humboldt Forum und seine persönliche Bilanz
ShareAuf welche berufliche Entscheidung sind Sie stolz?
Wenn ich an das Ende meiner Zeit an der SPK denke: Ich war froh, dass wir es wirklich geschafft haben, diese Reform kurz vor meinem Ausscheiden noch zu Ende zu bringen. Das schafft man nicht allein, sondern immer nur im Team. Und öffentliches Bauen wird ja immer kritisiert, aber ich habe mal nachgezählt: In meinen 17 Jahren Präsidentschaft haben wir 14 Bauprojekte fertiggestellt. Das sind kleinere wie der Erweiterungsbau des Museums Berggruen, aber auch große wie die Staatsbibliothek Unter den Linden, das Neue Museum, die James-Simon-Galerie, das Humboldt Forum. Bei Letzterem war ich nicht Bauherr, aber natürlich intensiv damit befasst. Das kann sich sehen lassen. Außerdem haben wir unsere Haltung zu Sammlungen aus kolonialen Kontexten grundlegend verändert. Wir geben Dinge zurück, wenn sie geraubt und gestohlen wurden. Wir haben auch gelernt, dass wir dabei viel gewinnen können: neue Partnerschaften, Respekt und Wertschätzung, aber auch Gegengaben und neue Inhalte. Dabei sind großartige Kooperationen in Gang gekommen. Von den Benin-Bronzen können wir ein Drittel als Dauerleihgaben behalten. Man denkt bei Restitutionen immer erst an Frankreich und Präsident Macrons Rede in Ouagadougou 2017, aber Deutschland hat inzwischen ungleich mehr geleistet, allein die Stiftung hat inzwischen über 600 Objekte restituiert. Es war richtig, und deshalb bin ich darauf auch ein wenig stolz.
Welche bereuen Sie?
Vielleicht hätte man beim Humboldt Forum einiges anders entscheiden müssen. Hinterher ist man natürlich immer klüger. Das Humboldt Forum hat eine sehr komplizierte Struktur. Es ist der Ort für die Ausstellungen, aber das Eigentum an den Sammlungen und damit auch die fachlich-inhaltliche Betreuung und Erforschung, inklusive der Entscheidung über Rückgaben, liegt natürlich bei der SPK. Das sollte man noch einmal überdenken, man müsste das alles zusammenführen.
Was würden Sie mit dem Wissen von heute anders machen?
Man hätte schon früher anfangen können, die Struktur der SPK zu verändern. Wir haben aber die letzten fünf Jahre intensiv genutzt. Dabei merke ich, wie positiv sich das auswirkt. Den Einrichtungen mehr Autonomie zu geben, sie zu budgetieren und mehr Selbstverantwortung zuzulassen. Dabei verbunden mit der Verpflichtung, mehr zum Ganzen beizutragen. Damit hätten wir früher beginnen können.
Wen haben Sie gefördert?
In der Archäologie habe ich meine Studierenden gefördert. Etwa ein Dutzend hat bei mir promoviert, auch wenn ich die Lehre nur nebenbei als Honorarprofessor gemacht habe. Die jetzige Professorin am Institut für Prähistorische Archäologie der Berliner FU, Henny Piezonka, war meine Schülerin. Ich habe immer versucht, zu fordern und zu fördern, so wie ich es selbst erfahren habe. Und in meinen beruflichen Ämtern fand ich es immer wichtig, dass wir möglichst die besten Leute für unsere Führungspositionen bekommen. Dass die guten irgendwann wieder weggehen können, gehört dazu. Ralph Gleis hat einen unglaublichen Job gemacht an der Alten Nationalgalerie. Als er zum 1. Januar an die Albertina nach Wien gegangen ist, habe ich mich gefreut, wenn auch mit einem weinenden Auge. Wir haben aber zum Glück mit Anette Hüsch auch eine großartige Nachfolgerin.
Gab es schon mal einen Moment in Ihrem Beruf, in dem Sie gedacht haben: Das können Jüngere besser?
Vieles im Digitalen und im KI-Bereich, das können die Digital Natives besser. Ansonsten ist es normal, dass es nach 17 Jahren neue Ideen und Ansätze braucht. Es gibt ja diesen schönen Satz: Nur was sich verändert, bleibt. Marion Ackermann ist seit 1. März hier, und wir arbeiten wunderbar zusammen. Für mich ist es jetzt an der Zeit zu gehen, und das ist auch gut so.
Was können Sie besonders gut in Ihrem Beruf?
Ich arbeite und entscheide schnell. Das ist wichtig, wenn so viele Dinge auf dem Tisch landen. Und ich beantworte jede Mail, nicht nur die von Führungspersonen. Es ist mir wichtig, ansprechbar zu bleiben. Oft sind es ja nur zwei Zeilen, aber eine Antwort ist ein Zeichen. Mitarbeitende konnten sich immer an mich wenden, wenn sie ein Problem hatten oder Rat wollten. Vielleicht habe ich im unmittelbaren Arbeitsumfeld etwas zu wenig gelobt, weil Leistung für mich zu sehr eine Selbstverständlichkeit war. Und ich kann gut verschiedene Dinge zugleich machen. Ich meine damit jetzt nicht, während Videokonferenzen Mails zu schreiben. Aber ich habe während meiner Zeit hier bei der Stiftung auch zwei größere Bücher geschrieben. Ich kann nach Hause kommen oder morgens früher aufstehen und den Laptop aufklappen und einfach weiterschreiben, wenn die Dinge recherchiert sind. Ein Buch zu schreiben kann sogar eine Art von Erholung sein, Erholung von den Dienstgeschäften, weil es etwas Eigenes ist, für das nur man selbst verantwortlich ist.

Welches Fachbuch muss man gelesen haben?
Hans Jürgen Eggers’ „Einführung in die Vorgeschichte“. Das ist ein ziemlich altes Taschenbuch, das in die prähistorische Archäologie einführt. Eggers hat die frühe Entwicklung des Faches immer im Kontext der Geistes- und Ideengeschichte gesehen.
Welche berufliche Reise hat Ihr Leben verändert?
Ich bin viel gereist in der Vorbereitung zum Humboldt Forum. Wie man in Kanada, in Australien oder in der pazifischen Inselwelt Museen neu denkt, unter Einbeziehung der indigenen Gruppen, die dort leben, hat mir noch mal gezeigt, in welche Richtung wir gehen sollten. Überhaupt, die Inselwelt des Pazifiks zu erleben: allein Vanuatu, ein Staat mit 120 Inseln und 82 verschiedenen Sprachen. Da versteht man Wilhelm von Humboldt, der sich ja unter anderem mit pazifischen Sprachen befasst hat. Wir sind auch in Brasilien gereist, am Amazonas gewesen. Da war ich auch bei den Archäologen an der Uni in São Paulo. Dort waren Keramiken ausgestellt, die sahen aus wie aus der sibirischen Taiga, kamen aber aus dem Amazonaswald. Man weiß heute, dass Tongefäße nicht von den ersten sesshaften Ackerbauern hergestellt wurden, sondern von den letzten Wildbeutern. Mein Buch „Die Kinder des Prometheus“ hätte ich nicht so geschrieben, wenn ich nicht zur Stiftung gekommen und mit dem Humboldt Forum befasst gewesen wäre, das hat meinen Horizont enorm geweitet.
Welchen Rat haben Sie heute an Jüngere, die Ihren Beruf lernen wollen und am Anfang ihrer Karriere stehen?
Dass man sich sehr genau beobachtet, ob man neben dem persönlichen Interesse an einem Beruf wirklich auch die nötigen Fähigkeiten und Begabungen mitbringt. Wenn man Archäologe werden will, braucht man ein Formengedächtnis und historisches Vorstellungsvermögen. Neben den Begabungen braucht es die Begeisterung für eine Sache, dann schaut man auch nicht ständig auf die Uhr, wann die Arbeitszeit um ist, so wird das nichts, wenn man nach Höherem strebt.
Wenn Sie es sich frei aussuchen dürften: Haben Sie noch einen Traumjob? Außer Ihrem heutigen natürlich.
Ich hatte meinen Traumjob. Das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Es war Glück und Zufall, dass ich mich für dieses Studium entschieden habe. Dass ich dann diese Gestaltungsmöglichkeiten bekommen habe – was will man mehr? Ich freue mich jetzt auf die Zeit, die kommt, ich will noch einige Bücher schreiben, mit mehr Ruhe. Das ist für mich jetzt das Wichtige.
Wer wären Sie, wenn Sie beruflich nichts mit Kunst und Archäologie machen würden? Was würden Sie beruflich machen?
Ich wäre wahrscheinlich Jurist geworden. Darüber hatte ich anfangs nachgedacht, auch über ein Doppelstudium, Jura und Geschichte. Vielleicht wäre ich dabei in Restitutionsfragen gelandet, und der Kreis hätte sich geschlossen, wer weiß.
Wie schalten Sie am besten ab?
Beim Bücherschreiben. Und beim Sport natürlich. Und wenn ich mich mit meinen Enkeln beschäftige, das macht mir große Freude.