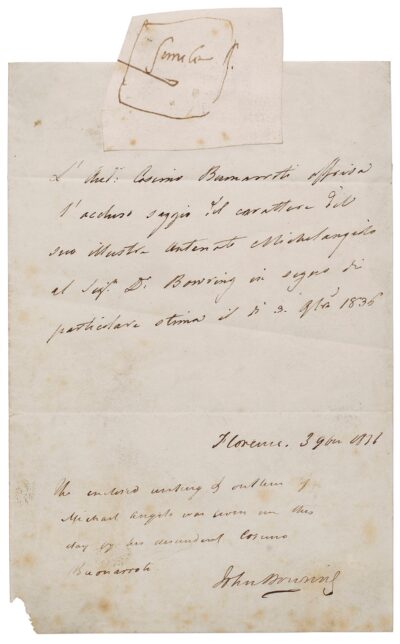„Je älter ein Bild ist, desto stärker wird es“
Der senegalesische Künstler Omar Victor Diop schlüpft für seine Fotografien in die Rollen historischer Persönlichkeiten und erzählt so schwarze Geschichte neu. Nun ist sein Werk bei Fotografiska in Berlin zu sehen
Von
06.02.2024
Wer sind wir als Gesellschaft, wenn unsere Geschichte jahrhundertelang nur aus einer Perspektive erzählt wurde? Der senegalesische Künstler Omar Victor Diop zollt mit seinen Fotografien Menschen und Ereignissen der schwarzen Geschichte Respekt. Damit diskutiert er unsere Erinnerungskultur zum Kolonialismus, zur gesellschaftlichen Unterdrückung und schwarzen Freiheitsbewegungen. Er sagt, nur eine Wahrnehmung und Wertschätzung anderer Perspektiven auf die menschliche Historie könne dazu führen, dass sich alle Menschen in der Gesellschaft zugehörig fühlten. Und Kunst sei der beste Weg, um diesen Diskurs zu führen.
Für „Diaspora“ von 2015 porträtierten Sie sich selbst als historisch bedeutende Persönlichkeiten der afrikanischen Diaspora zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert, die in den Geschichtsschreibungen immer vergessen werden. Wie kamen Sie auf diese Geschichten?
Ich war zu der Zeit mit einem Kunstförderprogamm in Spanien, eine ungewohnte Umgebung und ohne Zugriff auf meine sonstigen Models. Zur Inspiration schaute ich mir klassische Barockgemälde an und wie dort Licht als erzählendes Element genutzt wird, besonders auf schwarzer Haut. So stieß ich auf eine Reihe von schwarzen Männern aus dem 15., 16. und 17. Jahrhundert, die von großen Meistern der jeweiligen Zeit gemalt wurden. Das hat mein Interesse geweckt: Wer waren diese allem Anschein nach sehr wichtigen Schwarzen und warum hatte ich noch nie von ihnen gehört?
Also entschieden Sie, diese Personen zu werden für Ihre Bilder?
Der eigentliche Plan war es, die Kostüme anzufertigen und dann nach Dakar zu fliegen, um dort Modelle zu finden, die den Personen ähnlich sahen. Bevor ich flog, machte ich ein Testbild mit mir selbst und mein Galerist fand es so gut, dass er mich dazu brachte, weiter selbst die Charaktere zu verkörpern. So begann mein Motiv des Selbstporträts.

Wenn man einen Raum mit Ihren Bildern betritt, ist das schon ein interessanter Effekt, dass Sie selbst in dutzendfacher Ausführung auf einen herabschauen. War auch dieser Effekt antizipiert?
Der Effekt liegt in der Wiederholung. Manchmal sind auch in einem Bild viele verschiedene Charaktere abgebildet, die aber alle das gleiche Gesicht haben. Jede Dopplung fügt meinem Gesamtwerk eine neue narrative Ebene hinzu. Sie zeigt, wie all diese Geschichten und Personen zwar einzeln abgelichtet, aber im Thema verbunden sind. Es sind alles Beispiele von Widerstand und Excellenz. Und sie zeigen, wie schwarze Menschen über Jahrhunderte hinweg so viel Leid ertragen mussten, von Sklaverei, der Kolonialzeit, Unterdrückung, Apartheid bis hin zur antirassistischen Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten Staaten. Die Wiederholungen geben den Werken noch mehr Schlagkraft.
Wie kann man sich den Bildverarbeitungsprozess vorstellen?
Ich bin immer allein im Studio. Ich hatte noch nie eine Fotoassistenz oder ähnliches. Ich will nicht zu spirituell klingen, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal eine Verbindung mit den Personen aufzubauen, die ich darstelle. Als wären sie die zweite Präsenz im Raum.
Und doch sind es immer Sie auf dem Foto.
Wenn ich die Bilder ansehe, sehe ich nicht mich selbst. Wenn ich tief genug in die Geschichte der Person eingetaucht bin, vergesse ich manchmal, dass ich es bin, der auf dem Bild ist. Ich habe sehr früh eine Distanz zwischen mir und meiner Kunst aufgebaut. Es sind weniger Selbstporträts und mehr Theaterstücke.
Warum stellen Sie nur männliche Charaktere dar?
Mit der Frage tue ich mich sehr schwer. Soll ich auch die weiblichen Figuren verkörpern? Wenn ich das tue, wird die Darstellungsweise die Geschichte überschatten. Denn dann wird sich der Fokus von ihnen auf mich und meine Fähigkeit, mich in eine weibliche Figur zu verwandeln, verschieben.
Ihre starke, aber doch schmeichelhafte Beleuchtung in den Bildern erinnert an die Modefotografie der 1980er-Jahre.
Modefotografie hat die Eigenschaft, nostalgisch und zukunftsorientiert zugleich sein zu können. Und sie kann Ästhetik nutzen, um eine Nachricht zu vermitteln. Beide Aspekte inspirieren mich sehr. Designer wie Jean Paul Gaultier oder Fotografen wie Richard Avedon bewundere ich. Schöne Bilder haben eine eigene Stärke. Sie erregen leicht die visuelle Aufmerksamkeit.
Wie begannen Sie mit der Fotografie?
Am Anfang war das alles nur zum Spaß. Ich war in einem Unternehmen angestellt und sonntags spielte ich mit meiner Kamera herum. Erst fotografierte ich Landschaften, danach begann ich, in meinem Garten Porträts aufzunehmen. Auch als ich anfing konzeptioneller zu arbeiten und immer mehr zu inszenieren, habe ich mich nie als ernst zu nehmenden Fotografen wahrgenommen. Es waren Freunde, die mich 2011 dazu drängten, mein Portfolio bei der Bamako Encounters African Biennale of Photography einzureichen. Ich wurde tatsächlich ausgewählt, und damit machten sie mich erst zum Fotografen. Ich hatte vorher noch nie ein Bild von mir ausgedruckt, weil ich nicht dachte, dass sie das wert seien.
Seitdem arbeiten Sie als Fotograf?
Danach begann ich zumindest, das Ganze ernster zu nehmen und realisierte, dass ich durch die Fotografie viele Dinge korrigieren konnte, die mich frustrierten, zum Beispiel wie Afrika repräsentiert wird und wie wenig die afrikanische Realität sich darin widerspiegelt. Mir fehlte die Perspektive, wie es ist hier geboren zu sein, hier zur Schule zu gehen und ein Nachkomme meiner Ahnen zu sein. Und wie es ist, so viel Geschichte zu haben, die von großen Teilen der Welt übersehen und unterschätzt wird. Afrika ist ein Kontinent, über den viele entweder fantasieren oder ihn fürchten, ohne wirklich zu wissen, wie es hier ist, oder es wissen zu wollen. Ich wollte eine andere afrikanische Realität zeigen, nämlich meine. Und die besteht nicht nur aus Zebras, Giraffen und Rhythmusgefühl – all diesen faulen Klischees und Fehlvorstellungen –, sondern daraus, wer wir sind, wer wir waren und welchen Beitrag wir zu dieser Welt geleistet haben. Also habe ich es vor zwölf Jahren zu meinem Job gemacht, diese Verzerrung zu korrigieren.

Sie haben mal gesagt, dass es unabdingbar sei, neu über unsere Vergangenheit als Menschheit nachzudenken, um in Zukunft den Frieden zu bewahren. Wie meinten Sie das?
Überall auf der Welt beobachten wir ein Aufbegehren des Nationalismus. Die Menschen möchten eine einzelne Erzählung über die Orte, die sie als ihre Heimat beschreiben: Wir Franzosen sind so, und das ist unsere Geschichte. So funktioniert Geschichte aber nicht. Das, worauf sich diese Menschen berufen, ist oft nur die Geschichte eines sehr kleinen Teils der Bevölkerung. Unsere Gesellschaft muss sich aktiv dazu entscheiden, über diese Erzählung hinauszuschauen und alle Perspektiven einzubeziehen. Wir haben keine gemeinsame Zukunft, wenn nur die weiße westliche Gesellschaft in den Kontext gesetzt wird. Ein schwarzer Mensch wird sich in Frankreich nie zugehörig fühlen, wenn man ihm nicht erzählt, was die Geschichte schwarzer Menschen in Frankreich ist, wie weit sie zurückliegt und welche Traumata mit ihr verbunden sind.
Ist Kunst eine gute Form, um Wissen zu vermitteln und einen Diskurs zu starten?
Absolut! Es ist vielleicht sogar die beste Form. Kunst erlaubt es mir, meine Aussagen öffentlich zu äußern und das auf eine unbedrohliche Art. Ich klage die Besuchenden nicht an, sondern biete ihnen eine neue Perspektive. Kunst ist die einzige Art, wie ich sowas kommunizieren könnte. Meine Formel ist, dass ich etwas kreiere, das optisch ansprechend, aber so ungewöhnlich ist, dass es neugierig macht. Die Dopplung meines Gesichtes kann als so ein Verwirrungseffekt funktionieren. Das ist unerwartet, wirft Fragen auf und bringt Leute dazu tiefergehend mit dem Bild zu interagieren. So entdecken sie dann die politische Ebene und lernen oder werden Teil des Diskurses.
Und die Formel funktioniert?
Ja, es ist sehr amüsant zu beobachten, wie Menschen durch meine Ausstellung laufen, die Bilder betrachten und dann immer näher ran gehen und näher rangehen. Dann holen viele ihre Handys raus und schreiben etwas auf. Ich bin mir sicher, dass sie viele Dinge googlen werden, sobald sie zu Hause sind. Besonders nach „Diaspora“ habe ich viele Nachrichten erhalten mit Vorschlägen, welchen historisch vergessenen Afrikaner ich als Nächstes porträtieren könnte. Interesse zu wecken scheint also zu funktionieren, sogar in Ländern wie Japan oder Estland – Länder, bei denen ich mir vorher nicht sicher war, ob sie einen Bezug zur schwarzen Geschichte finden würden. Aber die Leute haben sehr stark interagiert und großes Interesse gezeigt. Manche sind sogar mehrmals gekommen.

Ihre Serie „Allégoria” von 2021 zielt sehr stark auf eine schöne Ästhetik ab. Es sind klar strukturierte Bilder mit starken Kontrasten, vor dunklen Hintergründen. Davor stehen Sie in außergewöhnlichen Kleidern und mit Tieren auf dem Arm, um sie herum ranken sich bunte Pflanzen. Was hat es damit auf sich?
Das ist die Serie, die mich durch die Pandemie gebracht hat. Ich hatte das Glück, hier im Senegal zu sein, während alles anhielt. Das nahm ich zum Anlass, aufs Land zu fahren. Die Natur ist hier sehr präsent, es wurde noch nicht alles vom Asphalt aufgefressen. Ich hatte den Wunsch eine Serie an Collagen zu erstellen, die ein Liebensbrief an Mutter Natur waren – etwas kryptisch, aber auch voller Fantasie. Ich wollte einen Effekt wie bei der senegalesischen Glasmalerei erzeugen. Auch dort wird mit bunten Farben vor dunklem Hintergrund gearbeitet. Bei der Komposition ließ ich mich von japanischen Farbholzschnitten inspirieren und auch von der farbenfrohen Einfachheit von Kinderbüchern. Ich malte mir beim Fotografieren eine Zukunft aus, Lebewesen und Pflanzen nur noch in der Erinnerung existieren und fragte mich, wie man sie dann wohl verewigen würde.
Viele der Tiere auf den Bildern sind bereits ausgestorben.
Ja, ich fand ihre Illustrationen in Lexika und platzierte sie am Computer in meine Arme oder um mich herum. Daher heißt die Serie „Allégoria”. Eine Allegorie ist eine bildliche Darstellung, die sinnhaft als Metapher für etwas Größeres steht. Die Tier- und Pflanzenarten sind alle bedroht oder bereits ausgestorben, wie der Dodo.
Jedes Jahr sterben Tausende Tierarten aus. Traurigerweise könnten Sie diese Serie wahrscheinlich endlos weiterführen …
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen! Die Fotos sind nur der erste Teil. Aktuell arbeite ich daran, sie zu animieren und Kindergeschichten dafür zu schreiben. Sie handeln davon, wie wir die Umwelt schützen können und wie wichtig Biodiversität ist. Ich plane, sie in viele afrikanische Sprachen zu übersetzen und sie auch dort aufzustellen, wo es kein Fernsehen hinschafft. Menschen in Großstädten sind für das Thema sensibilisiert , aber große Teile der afrikanischen Bevölkerung lebt nicht in Städten und hat nicht den gleichen Zugang zu dieser Bildung. 60 Prozent der senegalesischen Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Ich will sie mit Medien wie Kinderbüchern, Comics und Animationen erreichen.
Porträtfotografie wird im Senegal traditionell sehr geschätzt. Ist das bis heute so?
Ja, jede Familie hat eine große Wand, an der die inszenierte Porträts der Vorfahren, Tanten und Großeltern hängen.
War die senegalesische Porträtfotografie eine große Inspirationsquelle für Ihre Arbeit?
Ja, natürlich. Sie gehört zu meinem kulturellen Erbe. Wenn du hier im Senegal dein Porträt anfertigen lässt, machst du das nicht für heute, sondern für morgen. Wie ein Brief, den man an seine Ururenkel schreibt. Nicht jeder von ihnen wird uns persönlich kennen, daher versucht man, das Beste aus sich herauszuholen. Das ist die einzige Art und Weise, wie ich eine Kamera wahrnehmen kann – als etwas, das Dinge für spätere Generationen festhält. Je älter ein Bild wird, desto stärker wird es.
Für Menschen, die nie im Senegal waren: Wie ist es, dort als Künstler zu arbeiten?
Für die Kunst ist der Senegal sehr dynamisch und belebend. Unser erster Präsident war ein Künstler! Léopold Sédar Senghor war ein Schriftsteller und Poet. Ich lebe mittlerweile hauptsächlich in Paris, aber immer, wenn ich an meiner Kunst arbeiten muss, fliege ich nach Dakar. Hier muss etwas im Wasser sein, wie man so schön sagt. Kunstschaffende sind in der Gesellschaft sehr sichtbar und geschätzt. Junge Künstlerinnen und Künstler werden mit Initiativen gefördert, und es gibt auch eine Biennale in Dakar. Sie ist die älteste in Afrika und sehr bedeutend.
Und wie steht es um den Markt für senegalesische Kunst?
Er öffnet sich. Das betrifft ist aber nicht nur den Kunstmarkt, auch die Medien berichten mehr. Der Blick auf Afrika hat sich verändert. Es geht nicht nur um unsere Kunst, sondern auch darum, was das afrikanische Bewusstsein ist. Der kontinentale Kunstmarkt entwickelt sich ebenfalls. Es gibt immer mehr Galerien, die konkurrenzfähig und präsent bei großen, weltweiten Kunstveranstaltungen sind, zum Beispiel bei Paris Photo, der größten Fotografiemesse der Welt. Afrikanische Galerien eröffnen Standorte in Europa und afrikanische Künstler reinvestieren in den lokalen Markt. Die Welt ist immer globalisierter und vernetzter und es gibt immer mehr Quellen, die über den Kontinent aufklären. Früher konnten uns nur Fußballspieler und einzelne Musiker repräsentieren, jetzt ist jeder Afrikaner mit einem Handy ein Botschafter für diesen Wandel.
Service
Ausstellung
„Omar Victor Diop“
Fotografiska Berlin
bis 21. April


 Der Sound der Zukunft
Der Sound der Zukunft