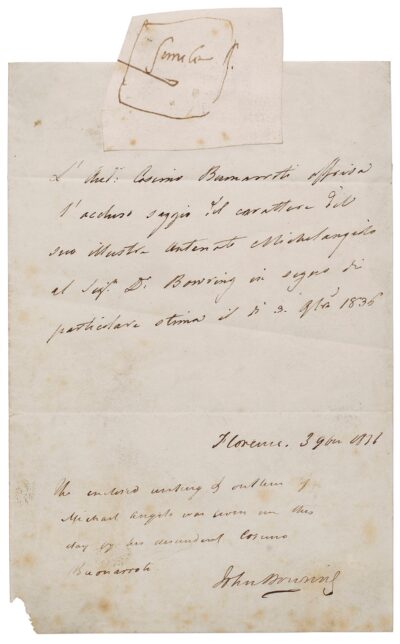Gnadenloser Beobachter
Liebhaber des Gesellschaftskritikers wünschen sich schon lange ein Museum für George Grosz. Jetzt startet es in einer ehemaligen Tankstelle in Berlin und will vernachlässigte Aspekte im Werk des Künstlers beleuchten
Von
12.05.2022
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 198
Judins Anwesen – eine ehemalige Tankstelle, raffiniert und preisgekrönt ausgebaut sowie durch einen kristallinen Ausstellungstrakt ergänzt – passt schon vom Standort zu Grosz: vor der Tür die ärmlichen Seiten des Berliner Großstadtlebens samt Straßenstrich, gleich nebenan am Nollendorfplatz die 1927 eröffnete Piscator-Bühne. Für den Theater-Avantgardisten lieferte Grosz Bühnenbilder, zeichnete jede Menge Kostümentwürfe. Jentsch beleuchtete 2015 in Solingen und Bayreuth erstmals diese Seite des Künstlers mit der Ausstellung „Alltag und Bühne. Berlin 1914–1931“. Die Leihgaben kamen damals fast durchweg aus dem Grosz Estate, dessen Bestand mittlerweile in Berlin untergebracht ist. Doch das kleine Grosz Museum soll nicht nur von einem einzigen Leihgeber, sondern durch ein ganzes Netzwerk von Sammlern bespielt werden. Die Bedingungen dafür sind gut, auch in den Augen von Jentsch, der ursprünglich an ein deutlich größeres Grosz-Museum mit viel wissenschaftlicher Forschung in seinem Archiv sowie Artists in Residence gedacht hatte: „Dieser Ort ist international eingeführt. Judin hat hier Galerieausstellungen gemacht, hat großartige Essen gegeben. Hier sind Museumsleute und Sammler weltweit ein und aus gegangen. Die Tankstelle ist international in der Kunstwelt ein Begriff.“
Durch einen Mietvertrag von erst zwei, anschließend noch einmal drei Jahren sehen sich die Initiatoren unter produktiven Zeitdruck gesetzt. „Klein“ heißt das Grosz Museum eben auch, weil es temporär angelegt ist auf maximal „fünf tolle Jahre, zehn tolle Ausstellungen, zehn Kataloge deutsch-englisch“, erzählt Karstens. Er hofft, damit Kulturpolitik und Stadtgesellschaft von einer Fortführung des Projekts zu überzeugen. Aber auch wenn eine dauerhafte Existenz gesichert ist, soll das Museum weiterhin klein, also wendig bleiben. Ohne namentlich benannten Leiter, ausschließlich in Teamarbeit – „mit einem Direktionsgremium aus Fachleuten“, heißt es in der Museumsbroschüre.

Eine behäbige, monothematische Institution wäre George Grosz nicht angemessen. An seiner wechselvollen Vita, der sprunghaften künstlerischen Entwicklung und dem so vielfältigen Werk mit Witzblatt-Illustrationen, dezidiert politischen Massenauflagen und exklusiven Grafikmappen, Fotomontagen, schließlich Gemälden scheitern selbst gut geölte Ausstellungsmaschinen. Dort bleiben mühsam recherchierte Einzelheiten oft Marginalien, kaum beachtete Fußnoten. Die Berliner Grosz-Enthusiasten aber wollen blinde Flecke kenntnisreich ausleuchten. Gegen Ende des Jahres werden Ralf Kemper, der zweite Vorsitzende, und andere die Russlandreise von 1922 nachzeichnen, auf der Grosz, KPD-Mitglied der ersten revolutionären Stunde, den Glauben an den Kommunismus verlor.
Bereits die erste Ausstellung „Gross vor Grosz“ lenkt den Blick auf sprechende, manchmal nebensächlich scheinende Details, um einen meist vergessenen, aber wegweisenden Abschnitt in Leben und Werk vor Augen zu führen. Der konzentrierte Parcours zur Eröffnung beginnt mit einem Jungen vom Lande, der sich im pommerschen Stolp die Welt erschließt, indem er aus dem wöchentlich angelieferten „Simplicissimus“ oder den „Fliegenden Blättern“ manches kopiert, aber aus dem linearen Illustrationsstil der Satirezeitschriften auch eigene, schon jetzt sarkastische Darstellungen entwickelt. Daneben zeigt sich das angeborene Talent, wenn der Schüler Bewegungsstudien eines Schwimmers beim Sprung vom Brett auf der Rückseite einer Strafarbeit skizziert oder literarische Motive von Karl May über Märchen und Detektivromane bis hin zu E. T. A. Hoffmann oder Edgar Allen Poe umsetzt. Derart gerüstet geht er 1909 an die Kunstgewerbeschule in Dresden; 1912 vollendet er sein Studium bei Emil Orlik in Berlin.
Mitstudenten, darunter Otto Dix, erinnern sich an eine Vorliebe ihres Kommilitonen für ausgewählte Garderobe. Georg Ehrenfried Gross aus Stolp tritt als Dandy auf, legt sich eine Sammlung edler Spazierstöcke zu. Und einen Künstlernamen: Als George Grosz signalisiert er den Anspruch auf seine Künstlerexistenz, und zwar sehr viel früher als bislang gedacht. Bereits der Dreizehnjährige signiert 1906 stolz als „Grosz“ und etabliert diesen Namen 1910 mit seiner ersten Veröffentlichung im „Ulk“ als Markenzeichen. „So verließ ich den schmalen hinterpommerschen Feldweg und bog in die breite Chaussee der Witzblattillustration ein. Es kam darauf an, mit meinem Talent Geld zu verdienen“, erinnert er sich 1929 im „Kunstblatt“.

Diese Aussage ließe sich als späte Reue und Geständnis lesen, denn nach Kriegsgräuel und seinem psychischen Zusammenbruch im Lazarett stellt der Zeichner spätestens 1917 sein Können in den Dienst einer politischen Sache: zuerst als „PropaganDada“ und Bürgerschreck, dann mit den Malik-Mappen „Gott mit uns“ oder „Ecce Homo“, die Prozesse wegen Beleidigung der Reichswehr und Gotteslästerung zur Folge haben. Mit seinen populären, provokativen Motiven tritt er ganz eindeutig, wenn auch nur einige Jahre, für die „proletarische Revolution“ ein.
Nachdem er sich schon 1927 über Monate zum Malen aus Berlin ins südfranzösische Cassis zurückgezogen hatte, geht Grosz 1932 in die USA, das Land seiner Seh- und Sehnsucht. „Ja, das reizt mich, dieses volle Leben darzustellen. Diese Blätter sind wahr – nicht pointenhaft satirisch. Ich bin auf dem Weg, dies Amerika für mich zu entdecken“, schreibt er im Sommer 1933 an Wieland Herzfelde. Und er verrät dem einstigen Malik-Genossen: Ich will keine ,billigen‘ Parolen illustrieren – ich möchte wahrhaftig sein in einem (bitte hau mich nicht) ,höheren‘ Sinne, im Sinne, wenn ich so sagen darf, des alten Meisters Bruegel.“

 Die besten Ausstellungen 2024
Die besten Ausstellungen 2024