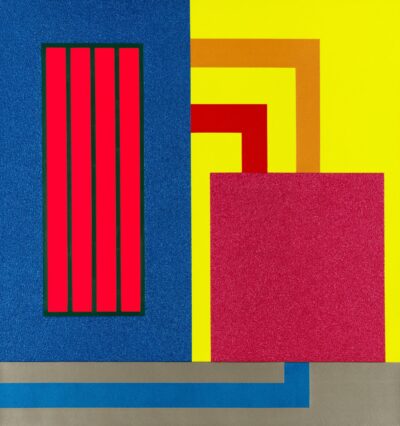„Eine Farbe kommt niemals allein“
Die Schriftstellerin Annabelle Hirsch hat den renommierten Farbhistoriker Michel Pastoureau im Pariser Vorort Boulogne besucht. Eine bunte Geschichte der Welt von den Barbaren bis zu Barbie
Von
16.08.2024
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 230
Zum Beispiel über das Verhältnis zur Religion. Schließlich war es der Protestantismus, der das Blau moralisch aufwertete, indem er es zur Farbe der zunehmend valorisierten Bescheidenheit, der Zurückhaltung und der Diskretion machte. Es sagt aber auch etwas über geopolitische Umbrüche und neue Handelsbeziehungen aus. Immerhin habe es der Entdeckung der Neuen Welt und des Imports der südamerikanischen Indigowurzel bedurft, um das Blau, das satte, kräftige Blau ab dem 17. Jahrhundert endgültig in den Herzen der Menschen, besonders in denen der Machthaber, zu verankern, so Pastoureau. Dann wiederum sei es aber auch eng mit der Kunst- oder in diesem Fall der Literaturgeschichte verbunden: Als Johann Wolfgang von Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werther“ in den 1770er-Jahren erschien und zu einem europäischen Bestseller wurde, stieg nicht nur die Selbstmordrate unter jungen Leuten dramatisch an, sondern auch die Anzahl blauer Fracks auf den Straßen. Wer seine Empfindsamkeit modisch unterstreichen wollte, trug fortan das Werther’sche Marineblau.
Farbe und Gefühl sind eng miteinander verbunden
„Das ist das Schöne an meinem Forschungsfeld“, sagt Pastoureau, „dass man sowohl in der Sozialgeschichte, der Literaturgeschichte, der Kunstgeschichte, der politischen Geschichte graben muss, um der Geschichte der Farben auf die Schliche zu kommen.“ In der Tat durchleuchten seine Bücher fast alle Bereiche des Lebens und lugen teilweise sogar bis in die Herzen der Menschen hinein. Schließlich sind Farben und Gefühle eng miteinander verbunden. So erfährt man zum Beispiel im bisher leider noch nicht ins Deutsche übersetzten Buch über das Grün, dass die Liebe keineswegs immer mit der Farbe Rot in Verbindung gesetzt wurde. Im Mittelalter, der Zeit der höfischen Liebe, des Minnesangs, der Blütezeit des spielerischen Flirts, war sie eher mit grünen Farbtönen assoziiert: grün wie die Jugend, grün wie der Frühling, grün wie etwas, das aufblüht. Dann wiederum aber auch: grün wie das Vergängliche, das Unbeständige.
Grün vertraut man nicht
Der Wandel zum Rot muss mit der Aufwertung der ehelichen Liebe zu tun gehabt haben. Pastoureau, der selbst seit vielen Jahrzehnten verheiratet ist, erklärt das so: Wenn die Liebe etwas sein soll, das nicht nur kurz aufflackert, wunderschön leuchtet, aber schnell verglüht, sondern auf Dauer angelegt ist, dann ist Grün als Symbolfarbe unpassend. „Das Grün ist eine faszinierende und zugleich suspekte Farbe. Man vertraut ihr nicht. Sie wird mit dem Changierenden assoziiert, dem Unbekannten, man weiß nicht, was von ihr zu erwarten ist.“ Lachend gibt er zu bedenken, es komme nicht von ungefähr, dass Marsmännchen oder Hexen in unserer kollektiven Vorstellung oft grün sind. Eine Erklärung für dieses Misstrauen liegt wohl darin, dass es lange schwer gewesen ist, einen anhaltend schönen Grünton zu produzieren. Die Farbe wollte einfach nicht halten, sie verfärbte sich sehr schnell, mutierte an Gewändern oder auch in der Malerei schnell zum Braun oder Gelb und ruinierte das Bild, erläutert Pastoureau. Ein weiterer Grund für das schlechte Image dieses Hoffnungstons wird sein, dass sich Menschen regelmäßig damit vergifteten. Theaterschauspieler zum Beispiel, deren Kostüme man mit bleihaltiger Farbe bepinselte, wurden krank. Napoleon soll daran gestorben sein, dass er die Wände seiner Exilvilla auf Sankt Helena mit dem Arsen enthaltenden „Schweinfurter Grün“ tapezieren ließ. Michel Pastoureau schmunzelt – ja, so sagt man das: „Napoleon erlag seiner Liebe zum Grün.“
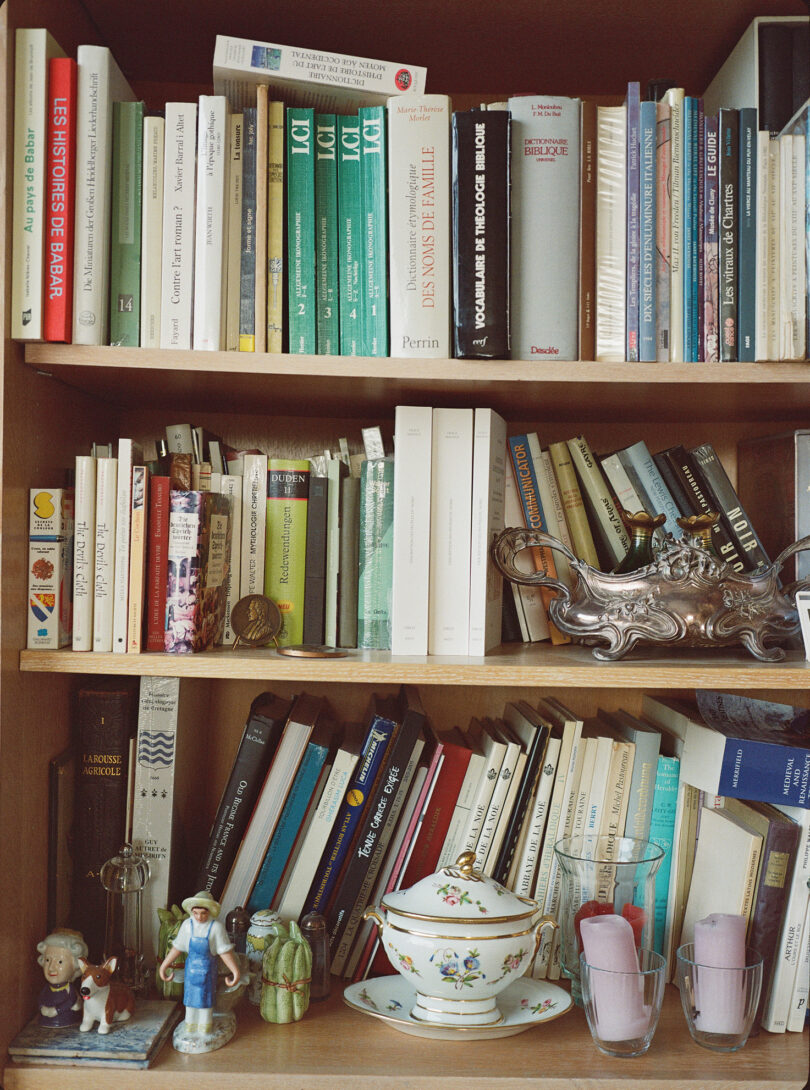
Das Unterbewusstsein ist ein grauer Ort
Er selbst teilt diese Liebe. Nicht nur mit Napoleon. Auch Goethe und Nero hatten angeblich ein Faible für diesen Ton, von dem Wassily Kandinsky sagte, er sei träge wie eine „dicke Kuh“. „Ach, der Kandinsky“, sagt Pastoureau und hebt die Augen mit ihren dunklen Wimpern zur Decke. Rührt seine persönliche Zuneigung zu dieser Farbe vielleicht daher, dass seine Mutter im Montparnasse der Fünfzigerjahre eine Apotheke führte, über deren Tür ein grünes Holzkreuz hing? Eines, das sie oft zusammen anstrichen? Er denkt nach. Das sei schon möglich. Unser Unterbewusstsein spiele uns farblich interessante Streiche, es schaffe teilweise die ungewöhnlichsten Verbindungen. Eine seiner liebsten Anekdoten zur Illustration dieses Gedankens dreht sich um André Breton, den Anführer der Surrealisten. Breton war ein guter Freund der künstlerisch gut vernetzten Eltern Pastoureaus, er kam oft zum Abendessen und bastelte anschließend Kartoffelstempel mit dem kleinen Michel, gerne in Fischform: „In meinem Gedächtnis trägt Breton immer eine sehr markante gelbe Jacke. Ich habe nie ein Bild gefunden, auf dem diese Jacke zu sehen ist, vielleicht hat sie nie existiert, doch in meinem Kopf gibt es ihn nicht ohne.“ Das Unterbewusstsein ist für Pastoureau übrigens ein grauer Ort: „Grau wie die grauen Zellen, wie die graue Substanz.“ Immer wenn er seine Suche nach einer Farbe und ihrer Geschichte beginnt, schaut er zuallererst auf die Sprache: Warum sagt man „Ich sehe rot“ und nicht „Ich sehe lila“? Warum bin ich „total blau“, nicht „total gelb“? Warum muss man „Farbe bekennen“ oder, wie im Französischen, „eine weiße Tatze zeigen“? Die Sprache gibt erste Indizien für die Rolle und die Symbolik einer Farbe in einer Kultur, sie ist der beste Startpunkt.