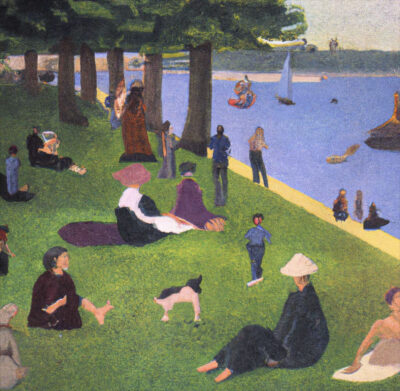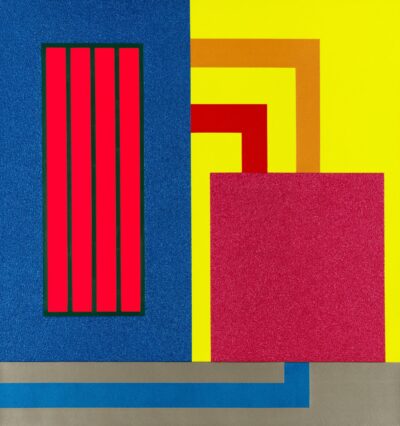Die Brexit-Verlierer
Vor drei Jahren trat Großbritannien aus der EU aus. Welche Folgen hatte das für den Kunstmarkt? Eine Bilanz aus rechtlicher Perspektive
Von
24.04.2023
Das Vereinigte Königreich verließ am 31. Januar 2020 die EU. Die ersten Monate waren für viele Wirtschaftszweige von Ungewissheit geprägt. Bilder von chaotischen Zuständen am Zoll und von kilometerlangen Staus an den Grenzen gingen durch die Nachrichten und verdeutlichten, dass es bereits an einer Infrastruktur fehlte, um die stark verflochtene Wirtschaft im Herzen des Kontinents nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch zu entzerren und an die neu entstandenen innereuropäischen Grenzen anzupassen. Während sich die Märkte im Allgemeinen mit der neuen Situation arrangierten, wird immer deutlicher, dass der Brexit insbesondere den Kunstmarkt besonders hart trifft. Zwar leidet der gesamte grenzüberschreitende Handel an der komplizierteren Rechtslage – zum Beispiel sind nun die einheitlichen Regeln des europäischen internationalen Privatrechts (etwa die Verordnungen Rom I und II oder die Verordnung Brüssel I) im Verkehr mit dem Vereinigten Königreich nicht mehr anwendbar, dafür gibt es eine Vielzahl zollrechtlicher Vorschriften. Einige Besonderheiten führen jedoch dazu, dass der europäische Kunsthandel ein deutlicher Verlierer des neuen Modus Vivendi ist. Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz.
Nach dem Art Basel and UBS Global Art Market Report 2021 wurden im Jahr 2020 20 Prozent des globalen Verkaufswerts des Kunsthandels im Vereinigten Königreich erwirtschaftet, 42 Prozent in den Vereinigten Staaten und 20 Prozent in China. Die Rolle Londons als Kunsthandelsmetropole mag einerseits historisch bedingt sein. Ein wesentlicher Aspekt war jedoch vor dem Brexit die niedrige Einfuhrumsatzsteuer von 5 Prozent für Kunstwerke, die älter als hundert Jahre sind (in Deutschland 7 Prozent, § 12 Abs. 2 Nr. 1 u. 2 UStG, Anlage 2 zum UStG; in Frankreich 5,5 Prozent, Article 278-0 bis Code général des impôts). Dies machte London zum Ein- und Ausfallstor internationaler Kunstimporte und -exporte in Europa. Sind Kunstwerke und Antiquitäten einmal in den Markt der EU eingeführt, wird keine weitere Einfuhrumsatzsteuer erhoben. Noch bedeutender ist jedoch der Umstand, dass seit dem Brexit für Importe aus der Europäischen Union in das Vereinigte Königreich die britische Einfuhrumsatzsteuer fällig wird – man bedenke, dass einige der weltweit wichtigsten Herkunftsländer EU-Mitgliedsstaaten sind, so etwa Frankreich und Italien. Auch die britische Regelung zur Einfuhrumsatzsteuerfreiheit bei temporärer Einfuhr hilft nach dem Brexit im europäischen Verkehr nicht weiter, denn bei einer Wiedereinfuhr in die EU wird dann die Einfuhrumsatzsteuer des jeweiligen Mitgliedsstaates erhoben. Was Importe aus der EU angeht, so hat London also beispielsweise im Vergleich zu Paris nicht nur einen Standortvorteil verloren – Großbritannien hat sich mit dem Brexit vielmehr einen bedeutenden Standortnachteil eingehandelt. Viele Europäer werden sich vor diesem Hintergrund bei Spitzenobjekten fragen, warum man dann nicht gleich in New York verkauft. Teurer wird es jedoch dadurch für alle. Laut Art Basel and UBS Global Art Market Report 2022 ging der Anteil des Vereinigten Königreichs an globalen Kunstimporten seit 2019 / 20 bereits um 4 Prozent zurück während immer mehr Kunstwerke aus Europa direkt in die USA exportiert werden.
Was den Kunsthandel insbesondere vom Handel mit herkömmlichen Gütern unterscheidet, ist die Anwendbarkeit von kulturgutschutzrechtlichen Vorschriften, die den Export und Import regulieren. Die britischen Gesetze zum Kulturgutschutz sind liberaler als die meisten europäischen Gesetze. Sie zielen darauf ab, dem Staat den Ankauf wichtiger Kulturgüter zu ermöglichen, sollen jedoch nicht deren Ausfuhr verhindern. Generell ist die Ausfuhr von Kulturgütern erlaubt, die sich weniger als fünfzig Jahre im Vereinigten Königreich befanden. Für niedrigpreisige Kulturgüter muss sogar keine einzelne formelle Exportgenehmigung eingeholt werden, solange eine generelle Erlaubnis des Exporteurs im Rahmen der Open General Export Licence vorliegt. Was auf den ersten Blick wie ein erheblicher Standortvorteil im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern wirkt, ist tatsächlich ein stumpfes Schwert. Voraussetzung für die legale Ausfuhr aus dem Vereinigten Königreich ist nämlich, dass das Kulturgut legal aus dem jeweiligen Herkunftsland ausgeführt wurde. Da eine große Anzahl der in London gehandelten Kulturgüter aber aus Mitgliedsländern der EU stammen, kommen so die strengeren kontinentaleuropäischen Regeln indirekt doch zur Anwendung. Wird hingegen Kulturgut, das älter als 250 Jahre ist, aus dem Vereinigten Königreich – nun wie jedes andere Drittland behandelt – in die EU eingeführt, so beschränkt die Verordnung der EU über das Verbringen und die Einfuhr von Kulturgut spätestens ab dem 28. Juni 2025 die Einfuhr und verlangt Nachweise über die legale Ausfuhr aus dem jeweiligen Herkunftsland nach dem 24. April 1972. So sehr sich das Vereinigte Königreich um einen für den Kunsthandel attraktiven Rahmen bemühen mag, am Ende hängt es doch am Tropf des kontinentaleuropäischen Markts, auf den es nun nicht mal mehr legislativen Einfluss nehmen kann.
Auch in Bezug auf den Artenschutz wirkt sich die zunehmende Regulierung des Markts der Europäischen Union indirekt auch negativ auf den Handel im Vereinigten Königreich aus. Konnte bisher in einem relativ einfachen Verfahren eine EU-weite Genehmigung für den Handel einer bestimmten Antiquität, in der eine geschützte Art verarbeitet wurde, erlangt werden, muss nun bei einem Export aus der EU in das Vereinigte Königreich im Rahmen eines strengen Verfahrens eine Exportgenehmigung – genannt CITES – eingeholt werden. Darüber hinaus ist durch die Änderung der Verordnung EG 865/2006 der Import und Export von Elfenbeinobjekten seit dem 19. Januar 2022 generell verboten. Wenn man sich verdeutlicht, wie häufig Elfenbein in Silberobjekten verarbeitet wurde – zum Beispiel als Isolierung an Griffen von Teekannen – hat auch diese Beschränkung für einige Händler erhebliche negative Auswirkungen.
Ein Kunststandort ist vor allem dann attraktiv, wenn sich einerseits Wohlstand und Expertise an einem Ort konzentrieren und andererseits ein vorteilhafter gesetzlicher Rahmen besteht. Während Wohlstand und Expertise in London zweifelsohne weiterhin vorhanden sind, wurde das Vereinigte Königreich durch den Brexit förmlich entlang der neuen Grenzen von seinem Markt abgeschnitten, was nichts anderes bedeutet, als dass plötzlich eine Vielzahl von Regeln und bürokratischen Hürden den Handel erschweren. Es wird sich zeigen ob bei der derzeitigen Rechtslage der kleine britische Markt ausreicht, um 20 Prozent des globalen Handels zu stützen. Derzeit profitiert London noch von einer für den Kunsthandel exzellenten Infrastruktur. Ob diese allein es ermöglicht, das Vereinigte Königreich zu einem Umschlagplatz ohne Hinterland zu machen, ist allerdings fraglich.