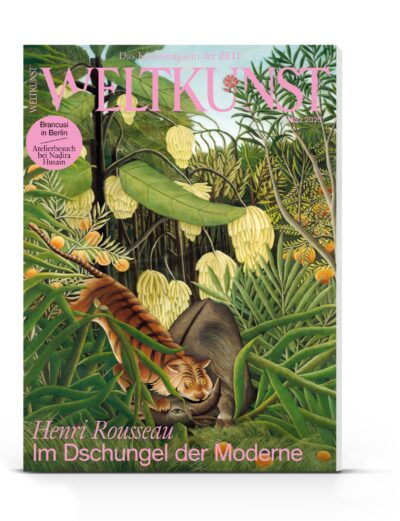Stille Dramen
Er war einer der größten Maler, den die Schweiz jemals hatte: Vor 100 Jahren starb Félix Vallotton, an den nun eine große Retrospektive in Lausanne erinnert. Das Porträt eines brillanten Einzelgängers und Virtuosen der Zwischentöne
Von
14.11.2025
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 246
Félix Vallotton kannte die Zerrissenheit, die Liebe und Begehren, Vernunft und Konventionen mit sich bringen können. Im Winterthurer Katalog nimmt Florian Illies die Beschreibung eines Landschaftsbildes zum Anlass, seinen Leserinnen und Lesern eine Idee davon zu vermitteln: Im Sommer 1896 fuhr Vallotton mit seiner Geliebten Hélène Chatenay in die Bretagne. Am kleinen Badeort Locquirec verbrachten er und Hélène, so Illies, „seine vielleicht glücklichsten Tage“. Trotzdem verließ er sie, um Gabrielle Rodrigues-Henriques zu heiraten. Die junge Witwe war wohlhabend – und die Tochter des Pariser Kunsthändlers Alexandre Bernheim, Gründer der Galerie Bernheim-Jeune.
Sechs Jahre später reiste Vallotton mit seiner neuen Frau und ihren drei in die Ehe gebrachten Kindern wieder nach Locquirec. Er mietet in demselben Hotel, sogar dasselbe Zimmer – vielleicht, fragt Illies, „um mit der neuen Frau das alte Leben fortzusetzen“? Jedenfalls malte er „zupackende, heitere Landschaften, scheinbar voll von Erinnerung und Vorahnung“. In kurzer Zeit entstand „fast ein Dutzend außergewöhnliche, neuartige Gemälde, so klar und frisch wie die Meeresluft um ihn“. Auf dem letzten aber, „Die Wolke“, zieht ein Gewitter auf. Zufall oder Zeichen? Das muss wie vieles bei Vallotton offenbleiben, aber man ahnt nichts Gutes. Andererseits: Gabrielle und er werden bis zu seinem Tod ein Paar sein. Und so hat es sich auch hier das Uneindeutige, Ambivalente auf der Leinwand bequem gemacht, wie 120 Jahre zuvor der Nachtmahr auf der Schlafenden im berühmten Gemälde seines Landsmanns Johann Heinrich Füssli.
Selbst bei seinen fröhlichsten, unspektakulärsten Bildern, „Am Strand“ von 1899, dem 1920 in Arles gemalten „Les Alyscamps, Morgensonne“ oder dem etwas zu aufdringlich beiläufigen Stillleben „Rote Paprika“ von 1915, bleibt ein Rest Unbehagen. Als Vallotton, damals noch Mitglied der Nabis, das kleinformatige „Am Strand“ 1903 in der Wiener Secession vorstellte, erntete er erneut schroffe Ablehnung. Einer der seinerzeit führenden Kritiker bemängelte die schrillen Farben, die unimpressionistische Flächigkeit und zog vernichtend Fazit: „Seine Landschaften sind das Unerfreulichste, was ich mir denken kann.“
Heute sind solche Urteile schwer nachzuvollziehen. Und dennoch, etwas an diesen Gemälden berührt einen unterbewusst unangenehm. Die Rückenfiguren auf „Am Strand“ wirken wie ausgeschnitten, körperlose Schablonen in einer vage definierten Landschaft. Für „Les Alyscamps, Morgensonne“ gilt das Gegenteil, die Bäume und Büsche in der Auffahrt zu dem Landhaus sind keine entleerten Hüllen, sie scheinen auf eine unheimliche Weise belebt. Die Schatten der Zypressen sehen aus wie Arme, die sich den Ankömmlingen entgegenstrecken, auch die Büsche rechts haben etwas Schillerndes. Sie sind Irrlichter, die einen verwirren und die Orientierung rauben sollen. Oder das Gemälde „Letzte Sonnenstrahlen“ von 1911: Neigen sich da die Bäume in der Abendsonne nicht einander zu wie Verschwörer, die ihre Köpfe zusammenstecken?

Bei Vallotton hat man den Eindruck, dass neben der sichtbaren Welt immer noch etwas in der Luft liegt – aus den Menschen ist das Leben gewichen, die Natur entwickelt unvermutet eigensinnige Kräfte. Disparate Energien, die nur in Unheil münden können. Vielen dieser Gemälde merkt man an, dass Vallotton der Symbolismus der Jahrhundertwende beeindruckt haben muss. Doch die Nabis waren keine naiven Träumer. Sie wussten genau, was sie taten: Ausdruck, Repräsentation, das Dargestellte – das betrachteten sie ungerührt aus der Distanz, nüchtern, reflektiert und kühl wie Physiker. Schon 1890 erklärte Nabis Mitglied Maurice Denis in seinem Essay „Die Definition des Neo Traditionalismus“, dass man nicht vergessen sollte, dass ein Bild, bevor es zu einem Pferd, einem Akt oder irgendeiner Geschichte wird, „zuallererst eine flache Oberfläche ist, bedeckt von Farben in einer bestimmten Anordnung“. Das lernte man damals an keiner Kunstschule.
Die Schau in Lausanne bietet grandiose Werke auf. Im ersten Stock werden in einer „immersiven Inszenierung“ (Catherine Lepdor) die politischen und satirischen Zeichnungen der Achtziger und Neunzigerjahre gezeigt. In der zweiten Etage erwarten die Besucherinnen und Besucher das spektakuläre, infernale Antikriegsbild „Verdun“ von 1917, das ganz und gar mysteriöse Frauenporträt „Herbst“ von 1908 und eine Serie von fünf Sonnenuntergängen, auf die die Kuratorinnen besonders stolz sind. Umwerfend ist auch „Die Theaterloge, der Herr und die Dame“. Das relativ kleine Werk hat aus Privatbesitz den Weg nach Lausanne gefunden, zum Glück, denn auch hier erweist sich Vallotton als Virtuose der Dramaturgie: zwei Flächen, eine gelb, eine umbrabraun, ein weißer Handschuh, ein halbes und ein vollständiges Gesicht und ein riesiger Hut erzählen einen ganzen Roman.
Doch eines der rätselhaftesten, modernsten Bilder ist „La Blanche et la Noire“. Es entstand 1913 und zählt nicht nur wegen seiner Abmessungen zu den Hauptwerken des Malers: Eine Frau sitzt auf dem Bett und raucht, die andere liegt ausgestreckt da, und für einen Moment weiß man nicht genau, ob sie die Augen geöffnet oder geschlossen hat. Die weiße Frau ist nackt, die schwarze bekleidet. Und: Sie raucht, was für eine Frau zu der Zeit besonders cool war. Mit dieser Arbeit bezog sich Vallotton direkt auf Édouard Manets „Olympia“, die 50 Jahre zuvor einen mächtigen Skandal auslöste. Doch dort waren die Rollen klar verteilt – die eine, die Kurtisane, bietet sich den Blicken des Publikums dar (das war der Skandal), die andere dient ihr, überbringt ihr einen Strauß Blumen und bleibt sonst in jeder Hinsicht im Hintergrund (das war damals kein Skandal).
Anders bei Vallotton: Hier dient niemand niemandem. Die beiden Frauen scheinen ganz offensichtlich in einem gleichberechtigten Verhältnis zu stehen – nur in welchem? Ist es eine Liebesbeziehung? Sind sie Komplizinnen in einer wie auch immer gearteten Scharade? Befinden sie sich überhaupt im selben Raum? Sind sie ein Traumbild, eine Allegorie? Am 5. Juni 1913 nannte der Künstler das Gemälde in einem Brief an seine Winterthurer Vertraute Hedy Hahnloser Bühler „mein größtes“. Und damit meinte er sicher nicht das Format. Hahnloser Bühler, die „La Blanche et la Noire“ wenige Wochen später erwarb, schrieb ihrerseits an ihre (und Vallottons) Freunde Henri und Jeanne Manguin Ende Juli 1913, dass sie keine Schwierigkeiten sehe, das Bild weiterzuverkaufen, wenn sie es einmal nicht mehr haben wolle, denn „es ist so zart und leicht zu verstehen, schon allein wegen des Themas“. Diese Einschätzung wird einen heute eher irritieren. Stattdessen keimt wieder der Verdacht auf: Es ist hier wie immer bei diesem Maler – es gibt erheblich mehr Fragen als Antworten. Und auch das ist eine unumstößliche Wahrheit: „Vallotton“, sagt Catherine Lepdor, „lässt einfach niemanden kalt.“
Ausstellung
AUSSTELLUNG
„Vallotton Forever. Die Retrospektive“
Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), Lausanne
bis 15. Februar 2026