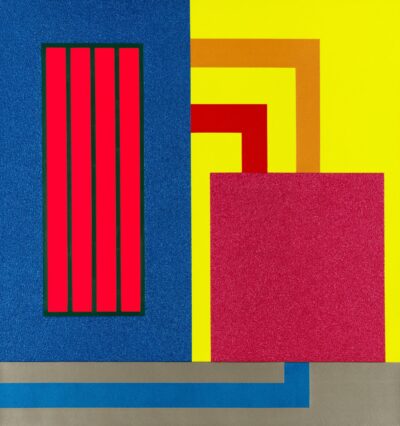Das Blau ruft
Der Künstler Julian Charrière taucht in einer spektakulären Ausstellung im Museum Tinguely tief in ozeanische Welten. Er feiert ihre fragile Schönheit und zeigt die Gefahren, die ihnen drohen
Von
03.07.2025
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 242
Auswirkungen hat die Eisschmelze, um die es in „Albedo“ letztlich geht, auch auf die Erde. Bislang funktionierten die Gletscher als Reflektoren, sie warfen die Strahlen der Sonne zurück und beschirmten so das Meer. Die klimatischen Veränderungen sorgen für eine veränderte Situation: In dieser „neuen Welt“, wie der Künstler sie nennt, bahnt sich das Licht seinen Weg in die tiefen, bislang dunklen Schichten des Meeres. Mit welchen Konsequenzen für die dort siedelnden Pflanzen und Lebensformen, weiß kein Mensch. Diesen Übergang, die Transformation des Planeten im Anthropozän, fängt die Kamera kongenial ein. „Albedo“ kennt keine festen Perspektiven, genau wie der Betrachter driftet sie schwerelos durch die Atmosphäre. Alles schwebt, ist instabil und jeglicher Kontrolle entzogen.
Sein Interesse an physikalischen, mit der Natur verbundenen Phänomenen teilt Charrière mit dem zwei Jahrzehnte älteren Ólafur Elíasson, an dessen Institut für Raumexperimente er nach seiner Zeit an der Universität der Künste Berlin studierte. Zusammen mit Andreas Greiner und Julius von Bismarck, die sich aus alter Verbundenheit bis heute ein Atelier teilen. Ihr Flächenbedarf in der ehemaligen Malzfabrik nahe dem Tempelhofer Feld wächst beständig – auch weil alle drei erfolgreich sind und ihre Werke zunehmend anspruchsvoll werden. Julian Charrière hatte Ausstellungen im Palais de Tokyo, im Dallas Museum of Art, in der Kunsthalle Wien, dem Museum of Contemporary Art in Tokio oder der Langen Foundation. Seine Arbeiten waren auf der Kochi-Muziris Biennale in Indien, 2017 auf der Biennale von Venedig und 2023 in der Parcours-Sektion der Art Basel zu sehen. 2016 erhielt er das Kaiserring-Stipendium für junge Kunst, außerdem ist Charrière der erste Preisträger des „Eric and Wendy Schmidt Environment and Art Prize“, der 2024 vom Museum of Contemporary Art in Los Angeles verliehen wurde.
Ein Video wie „Midnight Zone“ macht nachvollziehbar, weshalb seine Werke überall in der Welt gefragt sind. Sie verbinden künstlerische Sensibilität mit präzisen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Einsicht in die Verletzlichkeit eines Systems, auf das der Mensch immer mehr Einfluss nimmt. Seine Entscheidungen haben weitreichende Auswirkungen, die Charrière erst einmal interessieren. Statt zu urteilen, versucht er die Konsequenzen in Bildern zu fassen. Doch dann gibt es Pläne, die ihn erschüttert zurücklassen. Julian Charrière spricht vom deep-sea mining und hält es für eine der größten Gefahren des 21. Jahrhunderts. Weil sich in rund 4000 Meter Tiefe wertvolle Metalle wie Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan zu Knollen ballen, sollen letztere systematisch abgebaut werden. Dabei sind sie in doppelter Hinsicht wertvoll: Zur materiellen Komponente gesellt sich ihre Bedeutung für das maritime Ökosystem, dessen komplexe Zusammenhänge für uns nicht annähernd nachvollziehbar sind. Was passiert, wenn Roboter die oberste Schicht des Meeresbodens aufsaugen und anschließend zurück ins Wasser pumpen, um die Manganknollen zu „ernten“? Wie wirkt es sich aus, wenn die schwach magnetischen, bis zu 600 Millionen alten Energeispeicher ihren angestammten Ort verlassen? All das ist nicht ansatzweise erforscht.
Darauf bezieht sich „Midnight Zone“. In der sogenannten Mitternachtszone der Tiefsee schwindet die Sicht auf natürliche Weise. Um dies für das Video zu ändern, ließ Charrière eine Fresnellinse – die Linse eines Leuchtturms, die aus der Ferne Orientierung bietet – verkehrt herum ins Meer hinab. Sie dreht sich weiter, verteilt ihr Licht punktförmig im Kreis, macht unergründliche Konturen und Kreaturen sichtbar. Dokumentiert wird ihr Tauchgang dank der Kamera eines ferngesteuerten Tiefseefahrzeugs. Es ist eine Reise in einen Raum, der sich jeder Orientierung entzieht und wo jene polymetallischen Knollen als Objekte der industriellen Begierde inmitten uralter Ökosysteme ruhen.
Auch Julian Charrière kann nicht in die Zukunft schauen. Doch er weiß, dass wir uns besser nicht allein aus Gründen der Rohstoffgewinnung mit dem Thema befassen: „Die Wissenschaft kann die Tiefe kartografieren und vermessen, aber sie kann sie uns nicht spüren lassen“, sagt er. Wichtig sei eine „Kultur der Nähe, die uns emotional und imaginativ mit diesem riesigen Bereich verbindet“. Für ihn ist Kunst dieses Bindeglied. „Sie lädt uns ein, die Tiefe nicht als etwas Abstraktes oder als Ressource wahrzunehmen, sondern als lebendigen Raum, von dem unser eigenes Überleben abhängt.“