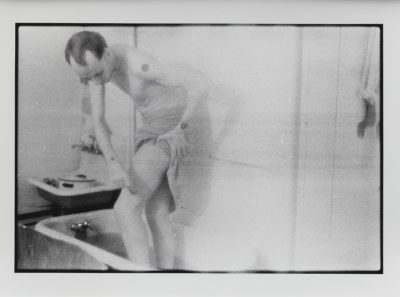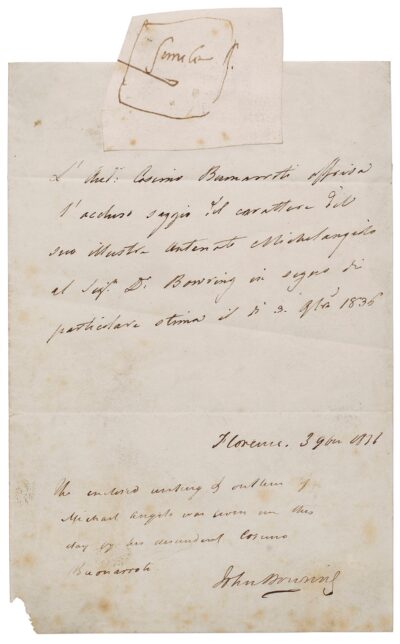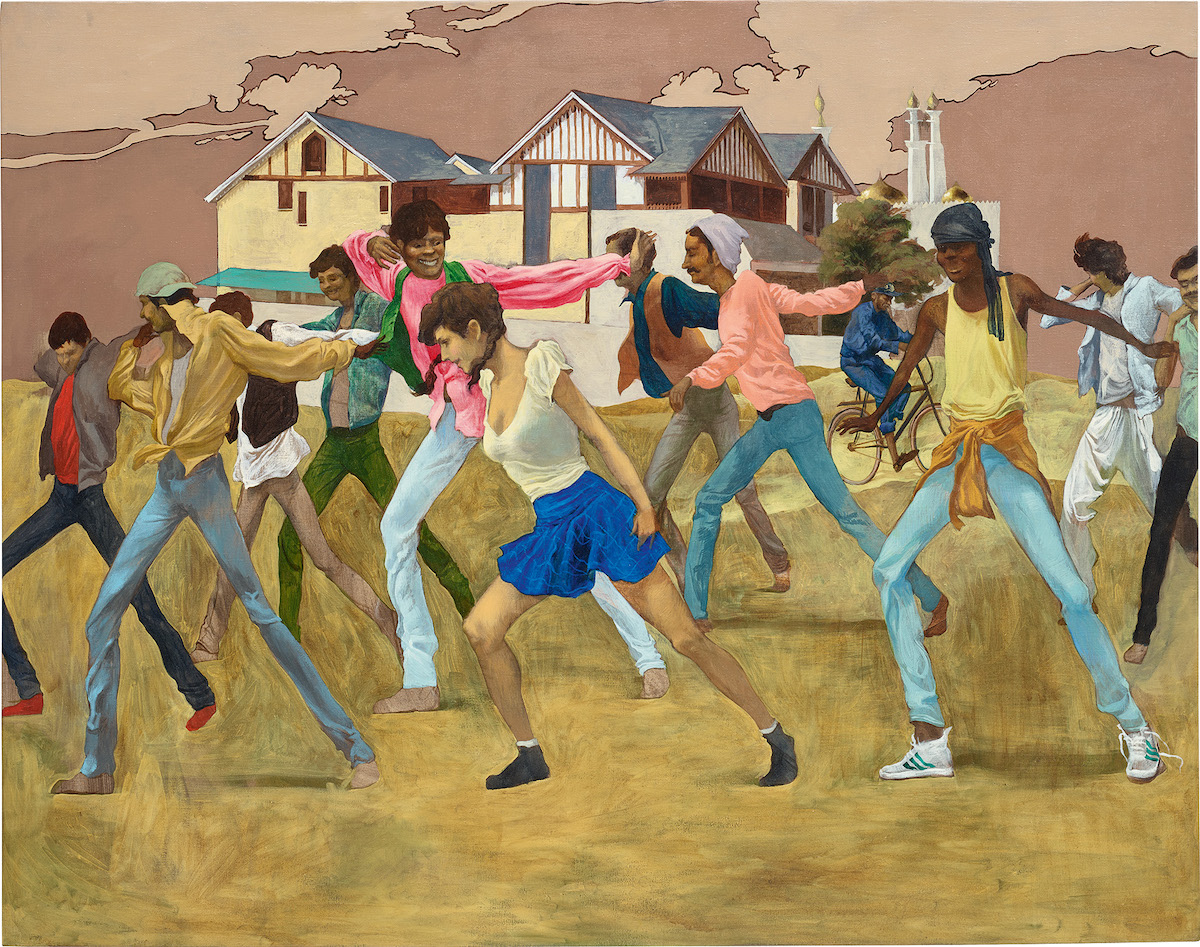
 Zauberwort lokal-digital
Zauberwort lokal-digital
Im Geschäftsjahr 2020 haben alle Auktionshäuser virtuell aufgerüstet und so Verluste kompensiert. Dennoch fehlte es bei der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts an Akquisitionen im High-End-Segment. Preistreiber sind derzeit die Käufer aus Fernost
Von
01.03.2021
/
Erschienen in
Kunst und Auktionen Nr. 2
Das Krisenjahr 2020 brachte vielen Auktionshäusern nicht nur weniger Umsatz – auch die Gewohnheiten ihrer Kundschaft änderten sich fundamental. Die Corona-Pandemie hat den Auktionsmarkt gleichsam auf den Kopf gestellt.
Jetzt weiterlesen mit 
Kostenloses Probeabo 0,00 €
Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat
- 4 Wochen kostenlos testen
- Danach 6,50 € pro Monat
- Monatlich kündbar
Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.