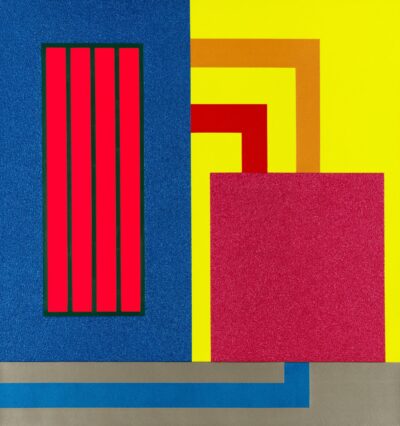Der Irrweg ist das Ziel
Seit der Antike verlaufen sich die Menschen lustvoll in künstlich angelegten Labyrinthen. Als Architekturen bieten sie Abenteuer mit ungewissem Ausgang und ähneln so dem Leben
Von
08.01.2025
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 235
Hin und wieder kann man sie in der Kathedrale von Chartres heute noch sehen: Menschen, die sich merkwürdig bewegen. Sie gehen in eine Richtung, dann drehen sie sich um und gehen langsam in die andere. Dabei folgen sie schwarzen Linien am Boden des Kirchenschiffs – diese Linien sind wie ein großes Mosaik. Und wenn man sie von oben betrachtet, ergeben sie ein Labyrinth. Verschlungene Wege, so verschlungen wie das Dasein auf Erden. Den Eingang findet man quasi von allein: Das ist die Geburt. Aber wann man den Ausgang findet, weiß man nicht: Das ist der Tod.
Es liegt eine namenlose Dramatik in diesem Laienspiel in Notre-Dame de Chartres. Und das alles könnte auch sehr gekünstelt wirken, wären jene, die hier die Fährnisse des Alltags nachstellen, dabei nicht so unglaublich ernst. Die Kathedrale von Chartres gilt als das erste der großen Gotteshäuser Frankreichs, ein Urbild der Gotik, das die gut 90 Kilometer südwestlich von Paris gelegene Stadt turmhoch überragt. Solch spürbare Dominanz beschrieb der niederländische Universalgelehrte Johan Huizinga in seinem epochalen Werk „Herbst des Mittelalters“ (1919) als Architektur für ein System der Einschüchterung, dem sich – vom König bis zum Bauern – niemand entziehen konnte.
„Als die Welt noch ein halbes Jahrtausend jünger war“, so lauten die ersten Sätze bei Huizinga, „hatten alle Geschehnisse im Leben der Menschen viel schärfer umrissene äußere Formen als heute. Zwischen Leid und Freude, zwischen Unheil und Glück schien der Abstand größer als für uns.“ Und weiter: „Alles, was man erlebte, hatte noch jenen Grad von Unmittelbarkeit und Ausschließlichkeit, den die Freude und das Leid im Gemüt der Kinder heute noch besitzen.“
Selbst eher normale Ereignisse wie eine Reise, eine Arbeit, ein Besuch waren, so schrieb Huizinga, „von tausend Segnungen, Zeremonien, Sprüchen und Umgangsformen begleitet“. Zwar schildert der Historiker die Sitten und Gebräuche zur Zeit Jan van Eycks. Aber was im frühen 15. Jahrhundert Gültigkeit hatte, galt zweihundert Jahre davor umso mehr. Die Baumeister und Steinmetze, die um das Jahr 1194 damit begannen, die Kathedrale von Chartres zu errichten (die ihre Enkel und Urenkel 1260 weihten), wussten genau, weshalb sie in den Boden ein Labyrinth einlegen ließen. Das Leben: ein Labyrinth und Rätsel.

Das Labyrinth hat Ähnlichkeiten mit dem Kreuz. Sie sind grafische Figuren von enormer Kraft und Ausstrahlung, Respekt heischend und einschüchternd. Doch das Labyrinth ist nicht nur sehr viel unübersichtlicher, es ist auch verspielter, lustvoll die Fantasie anregend. Wer in seinem Garten Hecken in Kreuzform sät, wird dabei kaum an erotische Abenteuer denken. Bei einem Labyrinth ist das anders. Hier ist alles möglich. Und falls man sich die Heldinnen und Helden der griechischen Mythologie als reale Personen vorstellen möchte, werden Theseus in ferner Vergangenheit auf der Insel Kreta ähnliche Gedanken gekommen sein. Theseus, König von Athen, Sohn der Aithra und des Aigeus (alternativ zieht die Geschichtsschreibung auch die Vaterschaft des Meeresgottes Poseidon in Betracht), betrat das Labyrinth des Minotaurus, um das zu tun, was vor ihm noch keiner gewagt hatte: diesem menschenverschlingenden Mischwesen aus Stier und Mann den Garaus zu machen. Das ist der Ursprung der Erzählung vom Labyrinth – und von Theseus’ brutalem Meuchelmord hätte nie jemand erfahren, hätte ihm seine Prinzessin Ariadne zuvor nicht den nach ihr benannten Faden in die Hand gedrückt. Damit er danach wieder herausfindet aus dem Labyrinth. So zumindest berichteten es der Grieche Diodor und nach ihm noch etliche andere, zum Beispiel Plutarch, Hyginus und der römische Dichter Ovid im achten Band seiner Metamorphosen.
Angeblich stammt die Geschichte von Ariadnes Faden ursprünglich von Dädalus, dem genialen Erfinder der griechischen Mythologie, bis heute Schutzheiliger der Architektinnen und Architekten. Dädalus soll das Labyrinth des Minotaurus gebaut haben. Und ihn befiel bald offenbar das schlechte Gewissen, weil er ein dermaßen verwinkeltes Stück Architektur hingelegt hatte, dass dort niemand jemals wieder zum Ausgang zurückkehren konnte. Es sei denn, sie oder er hatte eine Freundin namens Ariadne mit einem ziemlich langen Stück Stoff in ihrer Tasche. Vielleicht war die bekundete Reue des Dädalus aber auch seine verkappte Eitelkeit, ein unglaubliches Bauwerk geschaffen zu haben, dem man nur mit einer List entkommt.
Der Altertumsforscher Karl Kerényi gibt im zweiten Band der „Mythologie der Griechen – die Heroen-Geschichten“ noch eine andere Erklärung für den Faden der Ariadne. Demnach war es eigentlich gar nicht so schwer, aus dem Labyrinth des Minotaurus wieder in die Freiheit zu gelangen. Theoretisch. Praktisch musste man aber auf exakt demselben Weg hinaus, wie man hineingegangen war, alle anderen Wege brachten tödliches Verderben. Und was Daidalos angeht, weiß Kerényi auch noch etwas anderes. Der Erbauer des Labyrinths war nämlich selber einmal darin eingesperrt, mit seinem Sohn Ikarus. Dädalus erfand das Fliegen, indem er für sie beide Flügel aus Federn und Wachs baute. Aber Ikarus war zu übermütig, kam der Sonne zu nahe und stürzte ins Meer, das man seitdem das Ikarische Meer nennt. Tragisch. Und wieder einmal: rätselhaft.

Seitdem hat das Labyrinth die Menschen fasziniert. Sie haben es als Allegorie begriffen, es in ihren Parks aus Büschen geschnitten. Sie haben es mit traditionellen Steinwällen an der Küste des englischen Cornwall errichtet, „um zu sich selbst zu finden“, wie die Erbauer des Labyrinths Kerdroya einem Reporter des Guardian erzählten. Und sie haben es zum Kunstwerk erklärt wie der Konzeptkünstler Robert Morris, der im Skulpturenpark des Nelson-Atkins Museum of Art seiner Heimatstadt Kansas City ein dreieckiges Labyrinth aus mannshohen Glasscheiben installierte.