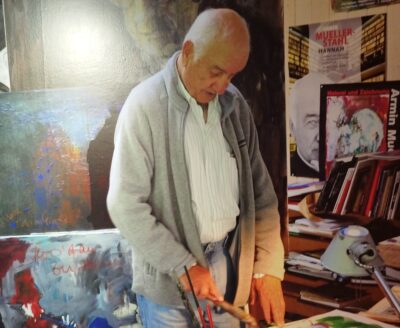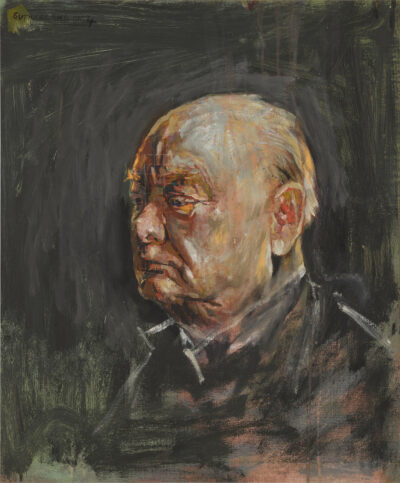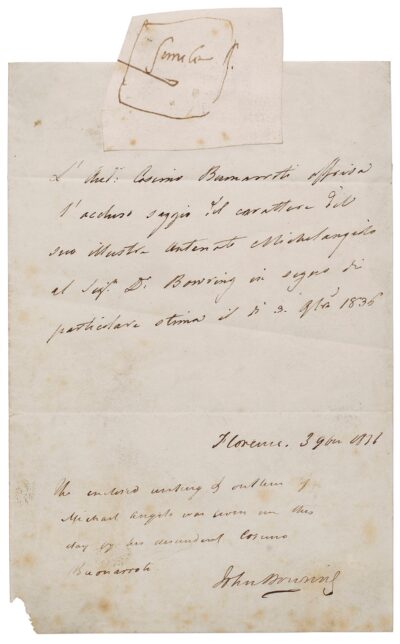Auf Wandelpfaden
Auf Wandelpfaden
Ein neuer Skulpturenweg soll Chemnitz und fast vierzig Gemeinden verbinden. Alexander Ochs, Kurator des Purple Path, über die Landschaft, den Bergbau und die verbindende Kraft der Kunst
Von
06.07.2023
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 215
Alexander Ochs stammt aus dem Fränkischen, wie man seinem rollenden R noch anhört. Viele Jahre hat er in Peking und in Berlin gelebt, im vergangenen Jahr ist er nach Chemnitz gezogen.
Jetzt weiterlesen mit 
Kostenloses Probeabo 0,00 €
Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat
- 4 Wochen kostenlos testen
- Danach 6,50 € pro Monat
- Monatlich kündbar
Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.