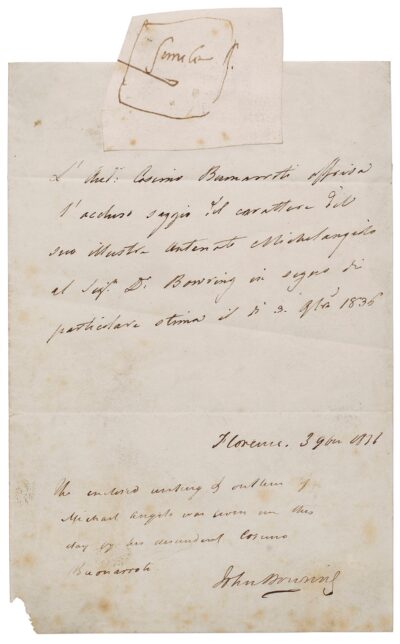Der Glühende
Der Glühende
Drei neue Bücher feiern den größten deutschen Kunstschriftsteller Julius Meier-Graefe. Florian Illies über einen mutigen Sprachartisten und seine späte Würdigung
Von
08.05.2023
/
Erschienen in
WELTKUNST Nr. 212
Zweiter Frühling für eine große Liebe: Endlich, fast hundert Jahre nach seinem Tod, schließen die Deutschen wieder Julius Meier-Graefe (1867–1935) in ihr Herz, diesen einzigartigen Kunstschriftsteller, der so schillernd wie entflammbar war und der zur Jahrhundertwende fast im Alleingang die französische Kunst in den deutschen Sehnerv einmassierte. Und zwar nur mit Worten.
Jetzt weiterlesen mit 

Kostenloses Probeabo 0,00 €
Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat
- 4 Wochen kostenlos testen
- Danach 6,50 € pro Monat
- Monatlich kündbar

Jahresabo 4,90 €
Alle Artikel frei zugänglich pro Monat
- 4,90€ pro Monat im ersten Jahr (danach 6,50€)
- 25% Ersparnis ggü. dem Monatsabo
- Jährlich kündbar
Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.