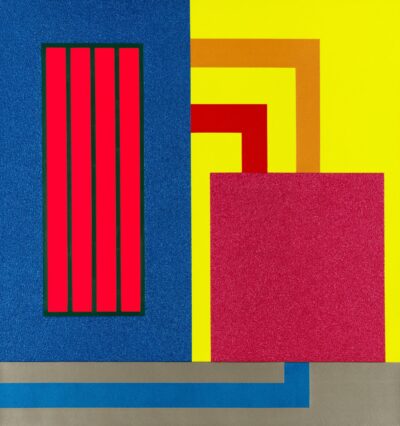Den Bildern wieder Würde geben
So mitreißende wie nachdenkliche Werke haben Julian Rosefeldt zum bekanntesten deutschen Videokünstler gemacht. In diesem Frühjahr zeigt C/O Berlin seine lange überfällige Retrospektive
ShareDer Umzug in die deutsche Hauptstadt im Jahr 1999 habe sich ohnehin als sehr vorteilhaft für seine Art zu arbeiten erwiesen, erzählt Rosefeldt. „Zum einen ist Berlin als Produktionsort fantastisch, weil es unglaublich viel Talent in der Stadt gibt, auf das ich als Teamworker auch absolut angewiesen bin. Und zum anderen bin ich als studierter Architekt ein großer Fan von Orten, deren Funktion sich schwer lesen lässt. Berlin ist ein Eldorado von Räumen, die seltsam wirken – und die ich dann in meinen Arbeiten mit sinnfremden Inhalten füllen kann, um so das Publikum noch stärker zu aktivieren.“ Wie in seinen frühen Arbeiten mit Steinle geht es auch hier darum, diese ignorierten Räume sichtbar zu machen. Aber auch die ignorierten Menschen: In „The Shift“ (2008) bewegen sich stumme Wächter und Hausmeister durch anonyme, futuristisch wirkende Multifunktionsarchitekturen, die man erst auf den dritten Blick als Hauptsaal des aufgegebenen Messegebäudes ICC oder als Treppenhaus der Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin identifiziert. Die Protagonisten dieses öden Schichtalltags scheinen in ihrem 17-minütigen Film-Loop regelrecht gefangen. Glaubt Rosefeldt, dass die Architektur, den Menschen formt? „Immer auch, natürlich“, antwortet er. Und verweist auf eigene Erfahrungen: „Bevor ich im Alter von 16 Jahren mit meinen Eltern in ein Reihenhaus umzog, bin ich in relativ hässlichen Westplattenbauten aufgewachsen, erst am Münchner Ring und später am Stadtrand. Ich fand das ganz furchtbar, die Proportionen dieser Gebäude sind kinderfeindlich, man steht da hilflos vor so einem unschönen Betonklotz.“ Es habe bei ihm eine innere Flucht ausgelöst, in Zeichnungen, Basteln, Bauen, erzählt er. „So hat sich bei mir wahrscheinlich das Bedürfnis entwickelt, ästhetisch dagegenzuhalten, was auch mein Interesse für die Natur, für andere Stadtbilder, für eine andere Art zu leben geweckt hat. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass ich Architektur studiert habe.“

Ein weiterer Fluchtort als Teenager war das Kino. Die Retrospektiven im Filmmuseum unter der Leitung von Enno Patalas oder das Programm in der Schwabinger Lupe brachten ihm die Klassiker von Antonioni bis Truffaut nah. „Ich habe damals Kinofilme immer mit zwei unterschiedlichen Augen angeschaut“, erinnert sich Rosefeldt. „Mit dem einen habe ich mich gefragt, was sehe ich dort und was entführt mich gerade narrativ. Und mit dem anderen habe ich versucht zu verstehen, wie es gemacht ist. Wieso ist die Kamera bei Fellini oder Godard plötzlich an dieser einen bestimmten Stelle?“ Dieses doppelte Sehen hat sich bei seinen Werken teilweise in eine Art doppeltes Zeigen verwandelt, weil er in ausgewählten Augenblicken gern den Schleier der Illusion zerreißt. Manche Filmsequenzen wirken wie Making-of-Fotos: „Deep Gold“ etwa, 2013/2014 geschaffen für ein Ausstellungsprojekt zu Luis Buñuel, ist ein so frei erfundenes wie glaubwürdiges Insert zwischen zwei Szenen aus dessen skandalumwitterten Film „L’Âge d’Or“ von 1930 (siehe weltkunst Nr. 90), geistig verlegt ins Berlin der Zwanzigerjahre und ergänzt um eine Vorwegnahme des aktuellen Gender-Fluidity-Diskurses – doch am Ende einer mitreißenden Partyszene, die den Ausschweifungen in heutigen Hauptstadt-Technoclubs in nichts nachsteht, läuft eine müde Dragqueen hinaus ins Freie, das sich plötzlich als Rückseite des Kulissenaufbaus der bekannten „Berliner Straße“ im Potsdamer Studio Babelsberg entpuppt. Alsdann geht sie vorbei an Kostümgarderobe und Requisitentisch und besucht ein dort abgestelltes Dixi-Klo. Und die Magie des Moments ist relativ rüde entzaubert.
In der Recherche zu „Deep Gold“ las Rosefeldt verschiedene Künstlermanifeste. Was ihn anschließend zu seiner bekanntesten Arbeit führte: In den dreizehn, simultan projizierten Kapiteln der Videoarbeit „Manifesto“ (2015) schlüpft die Hollywood-Schauspielerin Cate Blanchett in zwölf verschiedene Rollen und spricht jeweils unterschiedliche Textcollagen aus den Proklamationen verschiedener historischer Kunstschaffender. Als Obdachloser mit Megafon schreit Blanchett etwa das „Draft Manifesto“ (1932) der kommunistischen amerikanischen Künstlervereinigung John Reed Club von der alten Radaranlage des Berliner Teufelsbergs. Als alleinerziehende Mutter mit Tagesjob als Kranfahrerin in einer Müllverbrennungsanlage zitiert sie Bruno Tauts Gedanken zur neuen Architektur aus seiner Zeitschrift Frühlicht. Und als Lehrerin einer Grundschule unterrichtet sie – etwas frech – die goldene Filmregel des Arthouse-Kino-Regisseurs Jim Jarmuschs zum Ideenklau, die auch als Rosefeldts Arbeitscredo gelten darf: „Nichts ist original. Klau von allem, was Inspiration ausstrahlt und deine Vorstellungskraft befeuert.“
„Manifesto“ wurde zum großen Durchbruch für Rosefeldt. Die Arbeit war als Installation in Museen, als Langfassung im Kino und auf Festivals zu sehen, und sein Name ist nun in Australien, China, Indonesien und sogar in Hollywood bekannt. Die Zusammenarbeit mit Blanchett sei durch einen glücklichen Zufall gekommen, erzählt der Künstler. Die Schauspielerin besuchte 2010 zusammen mit dem Schaubühnen-Intendanten Thomas Ostermeier die Vernissage von Rosefeldt in der Berlinischen Galerie. „Wir kamen ins Gespräch, und sie schlug spontan vor, irgendwann mal was zusammen zu machen“, erzählt er. Es dauerte dann noch einige Jahre, bevor er die Idee zu „Manifesto“ entwickelte. „Cate hatte in meiner Ausstellung vor allem dialogfreie Arbeiten gesehen. Und dann kam ich zu ihr mit meinem Vorschlag und dieser irren Menge an Text, den sie lernen sollte.“ Er lacht über diese Erinnerung.
Durch den Erfolg von „Manifesto“ bekam er Zugang zu großen Kulturorganisationen und Festivals, die meist über üppigere Produktionsbudgets verfügen als Museen. Sein jüngstes Werk „Euphoria“, finanziert von der Park Avenue Armory in New York und einigen Kunstfestivals, erlebte 2022 seine Uraufführung auf der Ruhrtriennale. Zwei Stunden lang spürt Rosefeldt in dieser Filminstallation der Geschichte der menschlichen Gier nach – sowohl mit den Gewinnern des kapitalistischen Systems, wie den freudig tanzenden Angestellten einer Bank, als auch den Verlierern, die um eine brennende Mülltonne versammelt Wirtschaftstheorien von Adam Smith bis Ayn Rand referieren. Zehn Jahre begleitete ihn die Recherche für dieses Projekt. Warum hat ihn gerade die Gier so interessiert? „Weil sie die treibende Kraft der Ökonomie und überhaupt die treibende Kraft der Menschheit ist“, antwortet der Künstler.
Zu „Euphoria“ steuerte auch Blanchett wieder einen Part bei: Sie lieh ihre Stimme einem sprechenden Tiger, der durch einen leeren Supermarkt streift. Dass das allegorisch gemeinte Raubtier am Ende auf die Gläser mit der Tomatensauce losgeht, wirkt leicht absurd. Die Irritation ist beabsichtigt. „Ich habe mit den Jahren gelernt, dass gerade die Momente in meinen Filmen, in denen etwas passiert, was ich mir vielleicht nicht einmal selbst erklären kann, die interessantesten sind, weil sich darin die Betrachterinnen und Betrachter mit ihrer eigenen Imagination am meisten ausleben können“, erzählt Rosefeldt. Es besteht also kein Zweifel, dass dieser Künstler uns seine prägnanten Bilder allenfalls als Gedankenanregungen liefern will. Das Denken dürfen wir dann schon selbst übernehmen.