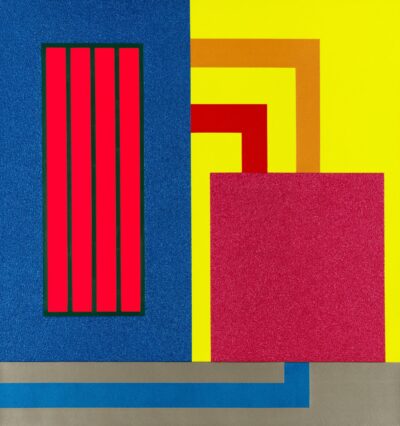Ein Prost auf die Menschen
Es ist an der Zeit, Frans Hals neu zu entdecken, der das Leben in Spelunken studierte und das Lachen in die Malerei einführte. Nachdem die große Schau in der National Gallery in London und im Amsterdamer Rijksmuseum zu sehen war, feiert die Berliner Gemäldegalerie den barocken Künstlerstar ab 12. Juli
Von
02.10.2023
/
Erschienen in
Weltkunst Nr. 217
Hals hat es seinem dankbaren Publikum aber auch leicht gemacht, ihn zu mögen. Er hat die Menschen so gemalt, dass man sich in ihnen noch zwei-, dreihundert Jahre später wiedererkennen konnte. Menschen, die lachen. Die uns zugewandt sind, verwandt und bekannt erscheinen.

Die Frechheit, mit der Hals seine Pinselstriche in die Antlitze seiner Auftraggeberinnen und Auftraggeber einschrieb, muss auf all die braven, gottergebenen Kaufleute und Hausvorstände gewirkt haben, als hätte jemand die bunten Bleiglasfenster eingeschlagen, mit denen sie sich die Welt da draußen vom Leibe hielten, auf dass das Licht der künstlerischen Wahrheit in ihre düsteren, aufgeräumten Stuben dringe. Aber mindestens genauso verrückt und impertinent war der Umstand, dass Hals die menschlichen Regungen nicht zur Ermahnung, Belehrung und Belustigung benutzte.
Er malte das Lachen, Essen, Reden, Trinken nicht von oben herab, er malte es auf Augenhöhe. Nicht umsonst ist ein Kapitel in dem sehr lesenswerten Londoner Katalog einfach mit „Laughter“ überschrieben. Dieser Willem van Heythuysen, der reiche Junggeselle, den es vor Übermut fast vom Stuhl haut, ist einer von vielen. Hals hat, um Nähe zu kreieren, eine eigene Formel gefunden, den über die Stuhllehne gelegten rechten Arm. Und menschliche Nahbarkeit, sie erkennt man natürlich auch im Alkohol. Doch Frans Hals war nicht nur deshalb ein Kneipengänger, weil er sich gerne einen hinter die Binde goss. Friso Lammertse, der Autor des „Laughter“-Kapitels, zitiert zwar den Amsterdamer Drucker, Verleger und Lyriker Dirck Pietersz Pers, dem das Bonmot zugeschrieben wird, Alkohol sei der „Bote der Poesie“. Hals’ Lehrer Karel van Mander fand, dass Bier und Wein die Seele des Menschen weckten, „weshalb der Gott Bacchus so oft Musen in seinem Gefolge“ habe. Und Govert van der Eembd, der zusammen mit Hals in einer satirischen Laienspielgruppe Poetry-Slam-ähnliche Aufführungen abhielt, war der Ansicht, dass „Wassertrinker“ keine „ordentlichen Gedichte“ verfassen könnten. Und dass die am schlimmsten wären, die in ihren Machwerken zur Mäßigung aufriefen, aber „drei Stunden später volltrunken“ seien.

Gaststätten waren nicht nur gut für Orgien. Es existieren historische Akten, aus denen hervorgeht, dass Haarlemer Wirte wie Jan Bossu und seine Frau in ihren Hinterzimmern Kunstwerke aufbewahrten, um sie Interessenten zu zeigen und zu verkaufen. Der Wirt Hendrick Willemsz den Abt war sogar alles drei: Maler, Wirt und Kunsthändler. Frans Hals hatte einen Bekannten in Amsterdam, Barend van Someren, mit dem er ein derart enges Vertrauensverhältnis hatte, dass er Taufzeuge von Hals’ Tochter Maria wurde. Auch van Someren war Maler, Wirt – und im Kunsthandel tätig. Auch sonst sollte man sich vor einfachen Lesarten hüten, dazu war die niederländische Kunst des 17. Jahrhunderts und die von Frans Hals im Speziellen zu vielschichtig. Ein Gemälde wie „Der fröhliche Lautenspieler“ von 1624–28, eine Leihgabe der Guildhall Art Gallery der City of London, stellt nicht etwa einen jugendlichen Musiker dar, der gerade ein Weinglas hebt. Es gehört wohl vielmehr zu einem Bilderzyklus, in dem Hals allegorisch die „Fünf Sinne“ illustrierte. Der sogenannte „Pekelharing“, der in London nur in der Leipziger Version zu sehen ist, das heißt ohne den Zinnkrug, mit dem ihn Hals auf dem Bild in Kassel auch schon gemalt hat – er ist kein verwirrter, verwahrloster Trinker. Sondern eine in den Komödien und Volksbelustigungen der Zeit gebräuchliche Kunstfigur, deren Status ungefähr dem Spötter oder Hofnarren entsprach – er war einer, der unbequeme Wahrheiten aussprechen und sich über andere lustig machen durfte. Nur die „Malle Babbe“, was so viel bedeutet wie die „verrückte Babbe“, war wohl wirklich auch im echten Leben eine Säuferin. Irgendwann hatte sie es in den Augen ihrer puritanischen Mitmenschen zu weit getrieben und landete in Haarlem „in einer Besserungsanstalt“, wie es dazu im Katalog der Ausstellung heißt. Aber auch da wollte Hals die Dinge nicht einfach so stehen lassen. Er malte ein zweites Bild von ihr, ohne den Bierhumpen, aber auch mit der Eule, die ihr auf der Schulter sitzt (es befindet sich heute im Metropolitan Museum New York, und Friso Lammertse und Jaap van der Veen halten es „wahrscheinlich für das Werk eines Assistenten“, ohne dabei hundertprozentig überzeugend zu sein). Diese Eule, so Kurator Lammertse, „verleiht dem Gemälde einen neuen, allgemein rhetorischen Sinn. Bei Laienspielen winkten Figurinen von Eulen denjenigen als Preis, die die treffendsten Aphorismen vorbrachten.“
Hals’ Sympathien waren in diesem Gesellschaftsspiel, aus dem damals schnell Ernst werden konnte, klar verteilt, nicht nur, weil auch eine seiner Töchter in die Haarlemer Besserungsanstalt eingeliefert wurde – wegen angeblicher Unzucht (sie hatte zwei uneheliche Kinder geboren). Aber was, nebenbei bemerkt, dagegenspricht, dass Hals selber ein so schwerer Trinker war, wie der Geschichtenerzähler Houbraken, seine Leserschaft glauben machen wollte: Er wurde für das 17. Jahrhundert ungewöhnlich alt. Mit 83 Jahren starb er in Haarlem, verarmt, aber bis zuletzt bei Sinnen.
Service
AUSSTELLUNG
„Frans Hals. Meister des Augenblicks“
Gemäldegalerie, Berlin,
12. Juli bis 3. November 2024