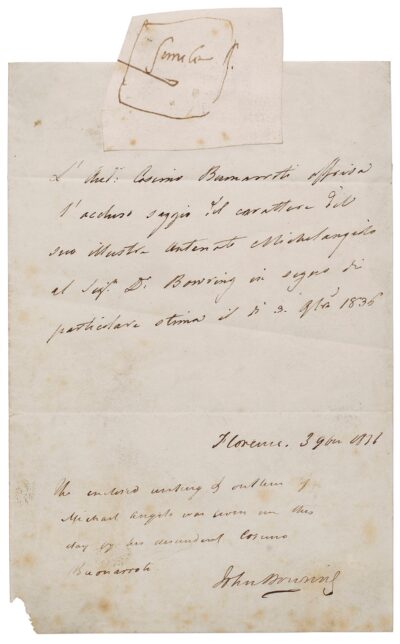„Krankheiten wandeln sich mit der Zeit“
Die Ausstellung „Kingdom of the Ill“ nimmt sich Fragen vor, die im Kunstbetrieb oft ausgeblendet werden. Sara Cluggish und Pavel Pyś erklären, wie Aktivismus die Museumswelt verändert, und was es mit der Identitätskrise der Kunstinstitutionen auf sich hat
Von
24.11.2022
Sara Cluggish, Pavel Pyś, lassen Sie uns mit dem Titel Ihrer Ausstellung beginnen: „Kingdom of the Ill“. Den entlehnen Sie einem Essay von Susan Sontag. Aber was soll das durchgestrichene Wort?
Pavel Pyś: Wir sind immer wieder zu Sontags Text zurückgekehrt. Sie ist sehr klar in ihrer Unterscheidung von krank und gesund. Aber so haben wir überhaupt nicht über das Thema nachgedacht. Wir hatten nicht das Gefühl, man wäre entweder das eine oder das andere, eher schien es uns wie ein ständiges Aushandeln. Sara und ich haben mit vielen Künstler:innen zusammengearbeitet, die chronisch krank sind. Ihre Ansichten haben uns in dieser Lesart bestärkt.
Moment, wenn man chronisch krank ist, kann man sich aber nicht dekonstruktiv gesund denken. Sehen Sie da die Gefahr, dass Sie Bedürfnisse von kranken Menschen unsichtbar machen?
Sara Cluggish: Absolut. Aber Krankheiten fluktuieren und wandeln sich mit der Zeit. Es ist ein Spektrum. In dieser Ausstellung wollen wir die eigenen Geschichten über Gesundheit und Krankheit der Künstler:innen in den Vordergrund stellen und dabei verschiedene Perspektiven einbeziehen: Care, mentale Gesundheit, Sucht und Genesung.

Eine These der Ausstellung ist, dass Krankheit an Dinge wie Politik und Nation gebunden ist. Wie hängt so etwas Persönliches mit diesen ganz großen Strukturen zusammen?
SC: Ein Beispiel. Wir zogen 2016 in die USA und mussten uns als Erstes in dem System der privaten Krankenversicherung zurechtfinden. Man soll da versuchen, sich um sich selbst zu kümmern, hat aber gleichzeitig das Gefühl, keine Kontrolle zu haben.
PP: Dieses Problem illustriert Johanna Hedvas Video „Untitled (Somebody Cheating Me)“. Darin wird die Alzheimer-Erkrankung von Hedvas Großmutter mit der kalten, unpersönlichen und gierigen Sprache der Krankenhausrechnungen zusammengebracht. Da steckt schon diese ganze Spannung drin.
SC: Johannas Großmutter liest alte Rechnungen vor und benutzt diese bürokratische Sprache. Johanna ist dann in der Position, für die Großmutter sorgen zu müssen. Diese Rolle ist ungewöhnlich, denn normalerweise spricht Johanna über die eigene chronische Krankheit. Eine komplexe und schöne Arbeit!

Sie haben Künstler:innen aus verschiedenen Generationen ausgewählt, aber die meisten Werke sind aus den vergangenen fünf Jahren. Dabei hätten Sie auch eine historische Ausstellung über das Thema machen können, von den Sechzigern bis heute. Warum dieser Zeitrahmen?
PP: Wir hätten ein sieben Mal größeres Museum gebraucht.
SC: Da hätten viele historische Arbeiten gepasst. Allerdings hat die Debatte im letzten Jahrzehnt an Fahrt aufgenommen, denn Künstler:innen bekennen sich zu chronischen Krankheiten, Institutionen machen Veranstaltungen zum Thema. Und die älteren Stimmen sprechen ja noch zu uns, nämlich durch die neuen Arbeiten der Ausstellung. Schauen Sie sich das New Yorker Duo Brothers Sick an – Ezra und Noah Benus – , die sich auf „Act Up“ beziehen, eine 1987 gegründete politische Initiative zur Verbesserung der Bedingungen von Aids-Erkrankten. Wir hätten auch die Arbeit der Organisation vorstellen können, aber wir wollten die Geschichte durch Werke von heute zeigen.
Die Installation der Brothers Sick bildet einen Eingang in die Ausstellung, die vier Stockwerke umfasst, und sie spielt auch auf die Coronapandemie an. Dann geht man eine Treppe hinauf und landet bei Shu Lea Chang und ihrer großen Cyberpunk-Videoinstallation, gleich neben den Skulpturen der feministischen Künstlerin Lynn Hershman Leeson. Im obersten Geschoss des Hauses ist ein ruhiger, wohltuender Riesenraum. Was für eine Geschichte wollen Sie erzählen?
PP: Die ersten drei Geschosse sind immersiv wie ein Labyrinth. Das gilt besonders für den dritten Stock, wo P Staffs Installation so gestaltet ist, dass sie von allen anderen Räumen sichtbar ist. Die oberste Etage ist dann ziemlich entspannt. Dort wussten wir, dass Barbara Gampers Installation Musik benutzt, aber ich habe nicht erwartet, wie sich der Klang verbreitet. Sie hören eine Marimba, und es klingt fast, als wären Sie bei einer Massageanwendung – wirklich seltsam. Hier herrscht etwas mehr Leichtigkeit, was vielleicht an der Erotik in der Arbeit von Juliana Cerqueria Leite und Zoë Claire Miller liegt, oder an dem sanften Licht, das von Heather Dewey-Hagborg und Phillip Andrew Lewis’ Pflanzeninstallation ausgeht. Danach hat man gleich ein hoffnungsvolles Gefühl.

Viele Arbeiten erzählen von Verwundbarkeit, Altern, Sucht, aber es geht auch um Umweltverschmutzung. Manche sind dabei sehr abstrakt, wie die Installation von P Staff, bei der aus einem dünnen Rohr säurehaltiges Wasser in Metallfässer tropft. Andererseits bringen Nan Goldin und die Organisation PAIN Überbleibsel von Protestaktionen gegen den Sackler-Konzern in die Ausstellung. Wie verhandeln Sie das Zusammenspiel von Kunst und Aktivismus?
SC: Wir zeigen Nan Goldins Zeichnungen, aber auch ihre Arbeit mit PAIN, einer Künstler:innengruppe, die sie mitbegründet hat. Sie benutzt Guerillataktiken, um gegen die Förderung durch die Sacklers zu protestieren. Die Familie besitzt den Konzern, der das süchtigmachende Opioid Oxycontin produziert und vertreibt, von dem auch Goldin abhängig war. Es gibt seither zunehmend eine Debatte um Philanthropie, Gesundheit und Kunst. Bei P Staffs Arbeit ist hingegen erstmal überhaupt nicht klar, wie sich das auf Krankheit oder den Körper bezieht. Aber die Installation hat mit Verschmutzung und der Durchlässigkeit der Haut zu tun. Es geht da um sauren Regen, eine ökologische Krise aus den Neunzigern.
Ich erinnere mich an diesen Niederschlag, der Steine und Wälder zum Erodieren brachte. Das ging aber vorbei und hat sich vor allem als lokales Problem herausgestellt. Ein interessanter Gegensatz zu den globalen Ökologieproblemen, denen wir heute gegenüberstehen. Was kann aktivistische Kunst da überhaupt noch tun?
PP: Wenn Sie etwas mit Kunst studieren, dann hoffen Sie, dass das Ausstellungsmachen den sozialen Diskurs ändern kann. Aber das ist ziemlich naiv, wenn Sie mich fragen. Mal rein finanziell betrachtet: Der größte Teil der Spenden in den USA geht ans Gesundheitswesen oder an Umweltorganisation, und nur ein kleiner Anteil geht in den Kunstbetrieb. Trotzdem haben die Künste eine riesige Rolle, die kulturelle Debatte zu verschieben.
Zum Beispiel PAIN: Die Aktivist:innen hatten einen Einfluss auf Institutionen – vielleicht ist das ja ein hoffnungsvoller Ausblick. Wie sehen Sie den die Zukunft von Institutionskritik und Aktivismus?
SC: Wir hoffen, dass Institutionskritik nie verschwindet!
PP: Die klassischen Werke der Institutionskritik können sehr didaktisch sein, wenn sie einfach ein politisches Statement illustrieren. Aber jüngere Künstler*innen gehen die Themen viel abstrakter an.
SC: Dabei sind aber nicht nur Künstler:innen gefordert. Die Museen müssen sich auch bewegen.

Ihre Ausstellung ist Teil der Reihe „Techno Humanities“, die das Museion als langfristiges Projekt angelegt ist, und die sich um Forschung, Subkultur und Ausstellungen dreht. Wie haben Sie darauf reagiert?
PP: Ursprünglich sind wir mit einem ganz anderen Vorhaben an das Museion herangetreten. „Techno Humanities“ war dann eine Art Filter: mit diesem Fokus auf Technologie, Wirtschaft, Ökologie und den Humanwissenschaften.
SC: Das hat der Schau einen Fokus und eine Struktur gegeben. Aber es gibt natürlich Raum für Fluidität, schließlich sind die Kategorien nicht so ordentlich.
Bart van der Heide, der scheidende Direktor des Hauses, hat mir erzählt, dass er glaubt, Museen wären in einer Identitätskrise, und die Reihe „Techno Humanities“ sei als Reaktion darauf konzipiert. Wie fügt sich „Kingdom of the Ill” in eine Krise, wo der Kanon unter Beschuss ist, wo Museen nicht länger das Monopol auf Sinnstiftung haben?
PP: Ich finde das super.
SC: Kannst du das näher ausführen?
PP: Natürlich schließt man mit jeder Entscheidung für eine Ausstellung jemanden aus. Man priorisiert, trifft Wertentscheidungen und ästhetische Urteile. Allerdings: Je mehr Institutionen Identitätskrisen durchmachen, desto besser. Die Institutionen ändern sich langsam, und der Diskurs ist schneller. Aber das bedeutet nicht, dass Museen am Ende sind.