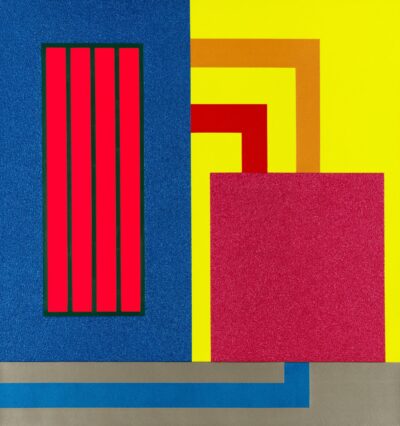Fette Ausbeute
Kritische Kunst, die soziale Ungerechtigkeiten thematisiert, steht hoch im Kurs. Doch für ihre eigenen Missstände ist die Kunstwelt oft blind. Dabei sind prekäre Arbeitsverhältnisse und soziale Demütigung im Hochglanzbetrieb leider verbreitet
Von
16.09.2022
/
Erschienen in
Kunst und Auktionen Nr. 14/22
Wursthersteller und Zeitarbeitsfirmen sind jüngst vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Sie wollten das geltende Verbot, Personal in Leiharbeit einzusetzen, kippen. Das Gericht sah in dieser Auflage, die prekäre Beschäftigungsverhältnisse verhindert, allerdings keine Betriebsgefährdung. Die Kunst-Community dürfte diese Entscheidung größtenteils begrüßen – thematisieren Ausstellungen doch regelmäßig soziale Missstände. Unter dem Titel „As Rights Go By“ versammelte 2016 beispielsweise der Freiraum Q21 im Museumsquartier Wien künstlerische Positionen, die Flüchtlingselend, Machenschaften multinationaler Konzerne und soziale und rechtliche Ungleichheiten anprangerten. Das „Kunstsystem“, so der Präsentationstext, „spiegelt die in der Gesellschaft zu beobachtenden sozialen und rechtlichen Ungleichheiten wider.“
Die strukturelle arbeitsethische Misere im eigenen Sektor wird kaum thematisiert. Dabei liegt seit fünf Jahren ein Bericht der Europäischen Kommission vor, der zum Ausdruck bringt, dass im Kunstbetrieb – wie in der Landwirtschaft und im Baugewerbe auch – prekäre Beschäftigungsverhältnisse überdurchschnittlich häufig zu finden sind. Und auch die Lektüre der Indikatoren für menschenwürdige Beschäftigung, die die Internationale Arbeitsorganisation IAO aufgestellt hat, macht schnell klar: Der Kunstbetrieb hat diesbezüglich recht viel Nachholbedarf. Sein kritischer Blick schweift weit, wacht global über die Menschenwürde – für die Probleme im eigenen Bereich scheint er aber blind zu sein. Kaum einer der oft freiberuflich oder auf Basis von Zeitverträgen ausgeübten Jobs bietet Arbeitsplatzsicherheit, Entwicklungs-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder gar Mitspracherechte. Ganz zu schweigen von einem Entgelt, das für ein menschenwürdiges Leben ausreicht. Natürlich: Es gibt in diesem Sektor auch viele, viele ehrbare Arbeitgeber. Aber zahllos sind auch die anonymen Berichte von Beschäftigten, die erzählen, wie sie vom Chef oder der Chefin vor versammelter Belegschaft zur Schnecke gemacht wurden, wie sie sich sonntags am Privathandy beleidigen lassen mussten – etwa als „unfähige Schlampe“. Arbeitsrechtliche Prozesse sind selten. Offen darüber gesprochen wird wenig – zu groß ist die Angst, danach keinen Fuß mehr auf den Boden zu bekommen.

„Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, heißt es in Max Ophüls 1932 gedrehter Verfilmung der Komischen Oper „Die verkaufte Braut“ von Bedřich Smetana. Doch die unsichtbaren „petites mains“, die den Betrieb am Laufen halten, die – so offenbar die weit verbreitete Meinung – ja ohnehin gerne für die Kunst leiden, arbeiten allzu oft in einem nahezu regelfreien Graubereich. Die namhaften Kunstzeitschriften in Paris bezahlen, wie allgemein bekannt ist, ihre Mitarbeiter kümmerlich oder gar nicht – trotz der tariflichen Richtlinien durch die von der UNESCO anerkannten Internationalen Vereinigung der Kunstkritiker „AICA“. Eine ehemalige leitende Redakteurin bestätigt die generelle Misere schulterzuckend: „Es ist eine Realität, mit der man zurechtkommen muss.“ Doch sollte nicht Kunst Realitäten verändern?
Derweil hört man auch bezüglich der Biennale in Lyon (bis 31. Dezember) von Chaos, Überforderung und Burnout. Es heißt, man halte dort Planungen nicht ein, verspotte sachorientierte Kritik. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien völlig überlastet. Es fehle ihnen auch an Rückhalt durch die Biennale-Direktion, die die Stimmung des Teams zwischen Depression, Resignation und Angst trotz deutlicher Signale nicht zu erkennen scheint – oder nicht erkennen will. Eine Nachfrage der Redaktion bei der Biennale-Direktion blieb unbeantwortet.

Die Ambitionen sind groß. Präsentiert werden sollen Künstlerinnen und Künstler aus mehr als vierzig Ländern, Hunderte von Werken – darunter viele Leihgaben: Aber die Mittel sind schmal. Die erheblichen finanziellen Probleme der wohl zu groß konzipierten Veranstaltung sind jedenfalls noch immer nicht gelöst. Gerade hat die Stiftung des Sammlers Antoine de Galbert zum Crowdfunding aufgerufen – angeblich weil Kürzungen regionaler Mittel der Veranstaltung zusetzen. Die allerdings sind seit dem Frühjahr bekannt.
Dass die international viel beschäftigten Starkuratoren Till Fellrath und Sam Bardaouil ihre Biennale ausgerechnet als „Manifesto of Fragility“ präsentieren, wirkt in diesem Kontext fast schon zynisch. Es gehe ihnen um Situationen der Zerbrechlichkeit, „die jeder der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler schon einmal durchlebt“ habe. Aber weder thematisiert die Veranstaltung die grenzwertige Situation der für sie tätigen Kunst-Arbeiter, noch die der Bevölkerung im unmittelbaren Umfeld der Schau. Dabei böte das Viertel mit den ehemaligen Arbeitern der pleitegegangenen Fabrik des Kleingeräteherstellers Fagor beste Bezugsfelder. Stattdessen schweift der kuratorische Blick wieder einmal in die Ferne – konkret: nach Beirut. Vorgestellt wird die leidvolle Geschichte der dortigen Seidenproduktion, die – so der Libanese Bardaouil – die Stadt mit der traditionellen Seidenstadt Lyon verbinde.
Ja: das Kunstsystem ist Spiegel der Gesellschaft. Macht der Betrieb krank, ist er krank. Wie heilen? Vielleicht durch ein Mitarbeiterwohl-Label für Kunstbetriebe, verliehen von einer europäischen Prüfkommission. Das wäre jedenfalls ein Anfang.