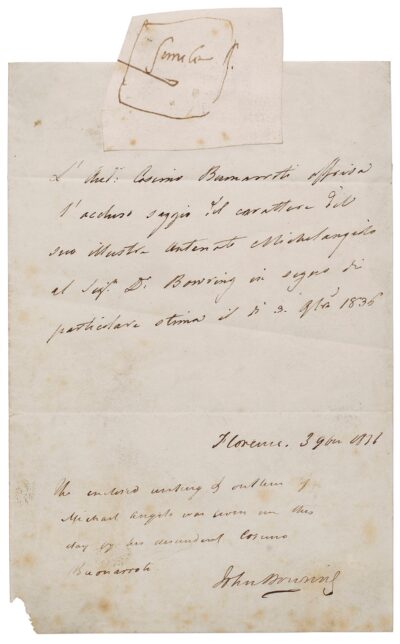„Pacifiction“ und die Kunst des Desasters
Der neueste Film von Albert Serra gilt schon jetzt als Meisterwerk. Heute kommt seine Südsee-Fantasie in Deutschland in die Kinos
ShareDer Videokünstler und Regisseur Albert Serra zählt zu den radikalsten zeitgenössischen Filmemachern, ein unerschrockener Kämpfer für die Freiheit der Filmkunst und ihren Ort: das Kino. Seit seinen frühen Filmen, von der Don Quixote Adaption „Ehre der Ritter“ über „Der Tod von Louis XIV“ mit Jean-Pierre Léaud als kongenialem Hauptdarsteller bis hin zu seinem neuesten Film „Pacifiction“ sucht Serra kompromisslos nach den richtigen Bildern. Wir haben Serra während eines Blitzbesuchs in Berlin getroffen. Vorführungen, Einladungen, Termine, und dann steckt auch noch die Band, die er am nächsten Tag in Paris treffen soll, um eine Platte mit Ingrid Caven aufzunehmen, wegen eines Streiks in Spanien fest. Ein Gespräch mit dem großen Stilisten zwischen Tür und Krawattenknoten.
Sind die Lieder für Ihren nächsten Film?
Nein, hier bin ich nur der Vermittler zwischen der Band (mit Marc Verdaguer) und Ingrid. Die Lieder sind schon geschrieben, ich habe nur ein wenig beraten. Marc hat die Musik für „Pacifiction“ gemacht. Ich mache es für Ingrid und weil es mir wahnsinnig Spaß macht. Ich bin ein Musikfanatiker!
Hören Sie Musik auch bei der Arbeit?
Ja, tatsächlich höre ich beim Drehbuchschreiben immer ein oder zwei Lieder in Endlosschleife über Kopfhörer. Das gibt mir einen Rhythmus. Meistens sind es melancholische Lieder. Für „Pacifiction“ waren das „Style it takes“ von Lou Reed und John Cale, eine Hommage an Andy Warhol, und „Lay me down again“ von Larry Jon Wilson. Diese beiden Lieder haben mir die Stimmung für den Film gegeben.

„Pacifiction“ ist Ihr bisher erfolgreichster Film. Er lief im Wettbewerb in Cannes, hat den renommierten Prix Louis Delluc gewonnen, die Cahiers du Cinema machten eine Titelstory und wählten ihn zum Film des Jahres. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Es ist der narrativste Film, den ich bis jetzt gemacht habe. Dazu ist das Thema zeitgenössisch. Mein voriger Film spielt ja im 18. Jahrhundert und war eine Auseinandersetzung mit der Libertinage. Das interessiert nicht unbedingt viele Leute. Da es mit „Pacifiction“ unter anderem um eine nukleare Bedrohung geht, hat der Film durch den Krieg in der Ukraine eine seltsam visionäre Seite bekommen und wurde so unerwartet aktuell. Aber ich denke, es sind vor allem die speziellen Qualitäten des Films, die ihm diese Aufmerksamkeit bescheren. Er ist ziemlich hypnotisch, man befindet sich in einer Art Trance. Und dann sind da noch diese tollen Schauspieler, Laien und Stars, wie der Hauptdarsteller Benoît Magimel. Also, da kommt einiges zusammen.

Wie kamen Sie auf die Idee, auf Tahiti zu drehen?
Ich wusste, dass ich in einer etwas exotischen Umgebung drehen wollte und habe mich für Tahiti entschieden, weil es das attraktivste der französischen Überseegebiete ist. Diese Region ist vom Tourismus verdorben, es ist richtig trashig und nuttig dort und es gibt nichts zu tun. Totale Dekadenz! Die Idee mit der Bedrohung durch eine mögliche Wiederaufnahme von Atomversuchen kam erst später. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber es war die Mischung aus der unsichtbaren Bedrohung und diesem scheinbaren Paradies, die mich überzeugt hat.
Auch wenn Sie sich in früheren Filmen schon an abstrakte, düstere Themen gewagt haben, spürt man, dass Sie mit „Pacifiction“ etwas Neues ausprobiert haben, eine andere Form filmischen Erzählens.
Ja, auf jeden Fall. Es ist neu, aber unter Beibehaltung einiger Arbeitsmethoden der bisherigen Filme. So haben wir auch hier fast ausschließlich mit Laien gearbeitet. Und beim Schnitt versuchen wir immer, eine bestimmte Sinnlichkeit zu erreichen, so dass der Film seine eigene, geschlossene Welt bildet.
Hatten Sie vor Drehbeginn eine Vorstellung von dem Film, die Sie jetzt in dem fertigen Film wiedererkennen?
Schwer zu sagen, weil ich mir eigentlich vorher nichts vorstelle. Wenn ich das Drehbuch schreibe, ist es für mich wie eine literarische Übung. Klar entstehen dabei Bilder, aber keine, die ich dann unbedingt auch verwirklichen möchte. Erst wenn das Ensemble am Drehort ist, verstehe ich ungefähr, was für Bilder es womöglich geben wird. Eigentlich ist es beim Schreiben des Drehbuchs nur wichtig, eine Person im Kopf zu haben. Das gibt Inspiration, sonst ist man blind. Die Figur von De Roller habe ich mit Benoît Magimel im Kopf geschrieben. Ich will einen guten Film machen, und nicht einen, der wie mein Drehbuch aussieht. Da gibt es von mir keine Vorteilnahme zugunsten meines eigenen Drehbuchs. Es ist die endgültige Qualität des Films, die zählt.
Das klingt so, als entwickle sich der Film ziemlich frei von der ersten Idee bis zum fertigen Schnitt?
Es gibt eben zwei, drei Hauptthemen, aber ich brauche eine totale Freiheit während der Entstehung des Filmes. Am ersten Tag hatte ich eine Hauptdarstellerin, die wieder verschwand, ihr Ersatz kam erst am zwölften Tag. Manche Dinge kosten viel Zeit, anderes passiert wie von selbst, ich weiß nie, welche Richtung ein Dreh nehmen wird. Ich nehme bei der Produktion alle Formen von Desaster an und richte mich danach. Ich bin sehr biegsam, was das angeht. Es sind letztlich die Leute vor der Kamera, die dann entscheiden, wohin der Film geht.
Sind Sie dann manchmal selbst von Ihrem eigenen Film überrascht?

Ich versuche einen Film zu drehen. Und das ist das, was Spaß dabei macht: überrascht zu werden. Während des Drehs versuche ich auch immer, das Publikum meines eigenen Films zu sein. Und schließlich ist es ja auch die Arbeit der Schauspieler, mich zu überraschen. Wenn sie nur das machen würden, was ich schon kenne oder was ich im Kopf habe, wäre es uninteressant. Sonst wäre ich selbst Schauspieler. Es ist die Vermittlung zwischen dem, was ich im Kopf habe, und einer anderen Person, die das Ganze komplex werden lässt. Ich arbeite wirklich sehr intensiv mit dem Cast und dem Druck, der Anspannung, die vor Ort entsteht. Wenn am Ende der Film nah am Drehbuch ist, schön, wenn nicht, auch gut. Für mich hat es beim Dreh eigentlich keinen Wert. Die Schauspieler lesen es eh nicht, vielleicht das Produktionsteam, um die Drehorte vorzubereiten. Wichtig ist es nur als eine Stufe im gesamten Entwicklungsprozess, auch was die Finanzierung eines solchen Projekts angeht.
Optisch ist der Film sehr eindrucksvoll. Man ist sofort von den Bildern eingefangen und einem echten Erlebnis ausgesetzt. War es Ihr ursprünglicher Wunsch, diese immersive Wirkung beim Publikum zu erzeugen?
Es gab eine große Menge an eindrucksvollen natürlichen Bildern, die uns dieser besondere Drehort geboten hat. Um den Eindruck eines dahintreibenden Abenteuers zu haben, wollten wir so viele wie möglich davon verwenden. Dazu haben wir mit ganz kleinen Kameras, Blackmagic Pocket Cinema Kameras mit Zoomobjektiven, auf 4K gedreht, mit der Idee, es im Nachhinein auf Film aufzublasen. All diese technischen Aspekte haben wir im Vorfeld festgelegt, damit die Kameramänner während des Drehs ganz frei arbeiten konnten.

Und die Szene auf dem Boot in den Wellen …
Das war nicht einfach, sogar ziemlich chaotisch. Wir hatten drei Kameras dabei, die waren nicht so glücklich auf dem schwankenden Boot. Wir haben etwa zwei Stunden gedreht, hatten dann die Nase voll, sind wieder an Land und haben was anderes gemacht.
Das Spiel der Darstellerinnen und Darsteller untereinander hat etwas kühl Distanziertes, das ganz selbstverständlich und natürlich wirkt. Wie kann man sich Dreharbeiten mit Ihnen vorstellen?
Ich mag keine klare Abgrenzung zwischen Fiktion und Realität und sehe keinen Unterschied zwischen dem Moment, in dem wir drehen oder nicht drehen. Ich arbeite immer mit Schauspielern. Das ist das Wichtigste für mich. Der Schauspieler ist verletzlich in seinem Schwanken zwischen spielen und nicht spielen. Wir drehen immer Variationen, verändern die Einstellungen, die Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen andere Dialoge, in veränderten Konstellationen. Oder zum Beispiel so, dass ich sage: erinnerst du dich an das, was wir vor zwei Tagen da und da gemacht haben, probiere es jetzt. Es geschieht immer etwas Unvorhersehbares. Ich versuche, am Set eine Gesamtstimmung zu schaffen, die dieses Unberechenbare passieren lassen kann. Mein ganzes System ist darauf eingestellt. Da muss ich niemandem etwas erklären, weil ich die unbedingte Intuition habe, dass es für den Film das Beste ist.
Können Sie dieses System beschreiben? Welche Kräfte wirken da?
Es geht darum, unbedingt die Bilder mit Intensität aufzuladen. Das mache ich mit Druck, auch mit Druck auf die Schauspielerinnen und Schauspielerinnen. Für mich ist ganz klar, dass Druck Intensität ergibt. Ich versuche Intensität auf eine kommunikative Art und Weise zu schaffen. Es muss eine ganz hohe Aufmerksamkeit bestehen. Es stimmt, dass Intensität mit dramatischen Situationen zusammengeführt wird. Aber eine Komödie, um lustig und originell zu sein, sollte auch aus großem Druck heraus entstehen, oder? Das ist vielleicht was für den nächsten Film. Der Kontrast zwischen einem komischen Inhalt und der Spannung des Drehs.
Arbeiten Sie schon an einem neuen Film?
Mitte Dezember war ich in Genf, um an einem neuen Drehbuch zu schreiben. Ich gehe immer in Hotels um zu schreiben, eher in schäbigen Hotels. Für „Pacifiction“ war ich in Dublin. Da war ich vorher noch nie gewesen. Ich mag eigentlich kein Bier, und das irische Essen ist grauenvoll, aber ich kannte dort niemanden. Jetzt hatte sich Genf ergeben, weil ich dort auch „Pacifiction“ vorgestellt habe. Ich möchte einen weiteren Spielfilm machen. Ich denke, es ist der richtige Zeitpunkt und ich will nicht zu lange warten. Ich habe aber noch keine Ahnung, um was es gehen soll. Nur die Vorstellung, dass es wieder zeitgenössisch sein sollte. Und dass es schön wäre, wenn die Hauptfigur eine Frau wäre, um mich zu fordern und um was Neues zu probieren.

Ich habe gehört, dass Sie parallel an einem Film über Stierkämpfe arbeiten?
Ja, es ist mein erster Dokumentarfilm. Wir haben schon angefangen zu drehen und begleiten zwei Stierkämpfer, zwei sehr junge Superstars in Spanien. Es geht vor allem um die spirituelle Seite des Kampfes, um die Verbindung mit der Tradition. Ich bin mit Stierkämpfen aufgewachsen, kein Fanatiker, aber ein Aficionado. Wir werden sehen. Es ist nicht meine Art zu arbeiten. Ich mag immersive, kurze und intensive Drehs. Hier filmen wir mal zwei Tage hier, drei Tage dort, dazwischen liegen Wochen. Aber das Thema ist super interessant! Und die Bilder sind gewaltig. Wir drehen ja echte Stierkämpfe. Bis jetzt waren wir nur in kleineren Arenen, da ist der Druck etwas niedriger. Und wir können uns Gedanken machen, was für Aufnahmen wir machen wollen, wenn wir in den großen Arenen drehen können.
Drehen Sie denn auch hier mit mehreren Kameras?
Ja, klar. Letztes Mal waren es neun oder zehn Kameras. Ich bin vielleicht der Regisseur auf der Welt, der digital am weitesten geht, um das Potenzial dieser Technik wirklich auszuschöpfen, sowohl beim Filmen als auch beim Schneiden. Ich habe über die Aufnahme von Stierkämpfe schon viel nachgedacht. In Sevilla habe ich eine Konferenz über die Fernsehübertragung von Stierkämpfen gemacht. Wenn man in der Arena ist, selbst in der hintersten Reihe, spürt man etwas, was in allen Fernsehübertragungen verloren geht, egal wie nah die Kamera an den Kampf kommt.

Deshalb muss ich wirklich experimentieren und proben, um etwas von dieser Emotion einzufangen. Das mache ich sonst nie, mir die Aufnahmen vor Ende des Drehs anzuschauen. Aber hier macht es total Sinn. Es ist sogar notwendig. Wir probieren einiges aus, und später, im Vergleich, schaffe ich es, mich zu entscheiden. Mit der Auswahl verstehen wir, was wir tun, was mächtig ist und was nicht. Im April, wenn die Saison wieder beginnt, drehen wir weiter.
Sie sind ein großer Verfechter des Kinos als Aufführungsort für Filme. Glauben Sie an die Zukunft des Kinosaales?
Das Kino muss seinen Platz finden, mit seinen ganz eigenen Eigenschaften. Wenn man sich darauf einlässt, dass der Film etwas Eigenartiges ist. Das ist eine Frage, an der ich mich permanent auf eine praktische Art und Weise orientiere. Wenn ich schneide, behalte ich die Bilder, von denen ich denke, dass sie nur Film sind. Keine Kunst, kein Experimentalfilm, nein: Film. Fast immer sind das auch die Bilder, die am schönsten, am gelungensten sind. Film ist die Vereinigung von allen Elementen. Es steckt so viel in den einzelnen Bildern drin. Es braucht die große Leinwand und die Bedingungen, um alles zu erfassen, um daran Freude zu haben, Bilder zu konsumieren. Ich bin optimistisch, was das Kreative und das Finanzielle angeht. Für mich ist Film Hochkultur. Es ist das, was das Leben erträglicher, aufregender, komischer und schöner macht. Und es ermöglicht Selbstkritik. Wie eine Katharsis. Der Film ist wirklich das Einzige, was alle Opfer rechtfertigt. Schlechtes Kino steht für schlechtes Leben.

 Das Leuchten des Atlantiks
Das Leuchten des Atlantiks