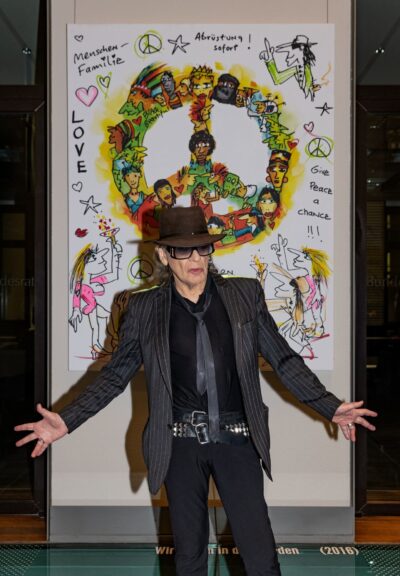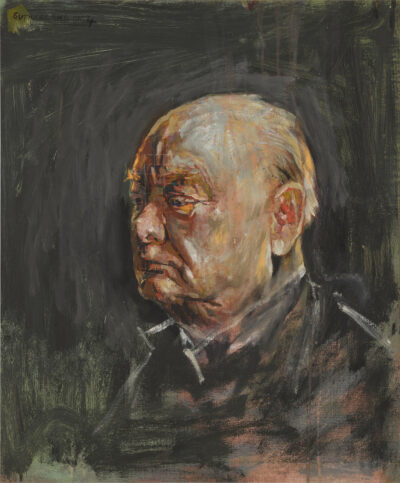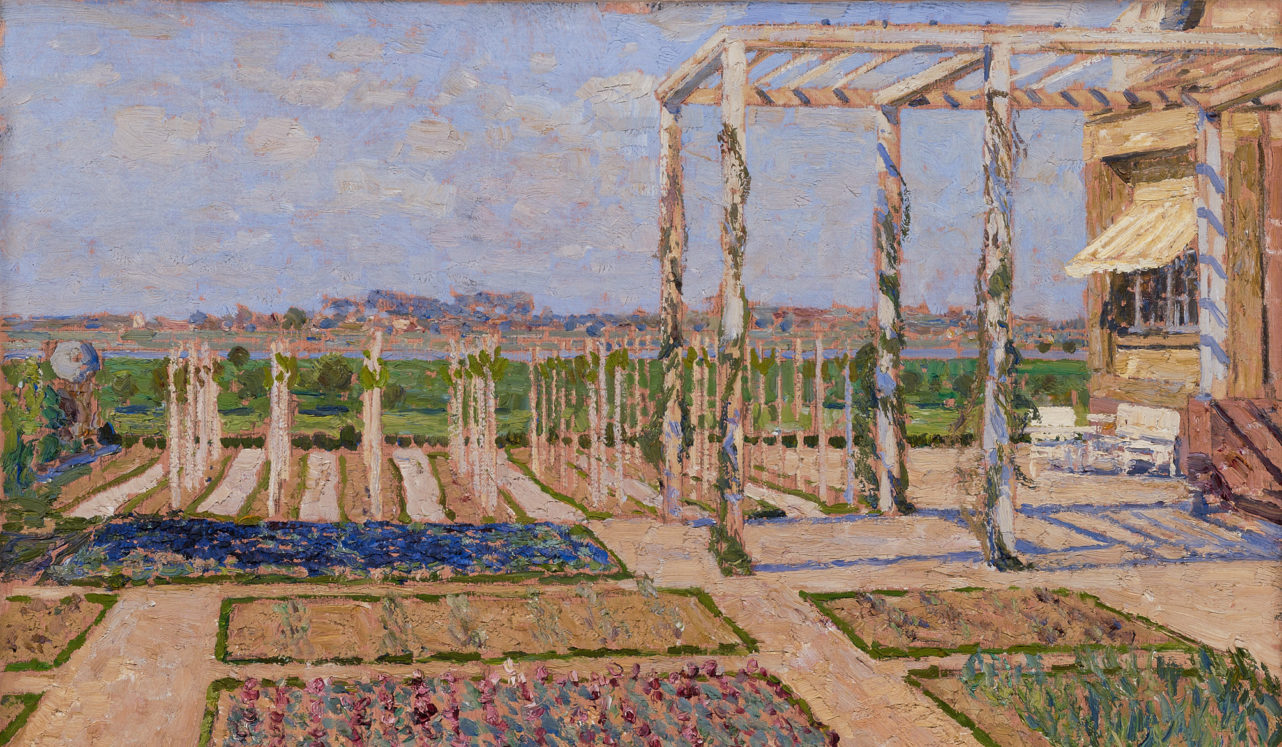
 Naturschau von innigem Erleben
Naturschau von innigem Erleben
In den Landschaftskonzeptionen des Düsseldorfer Künstlers Max Clarenbach klingt die leuchtende Malerei französischer Impressionisten und Fauves nach. Auf dem Kunstmarkt bleiben seine Gemälde überwiegend erschwinglich
Von
07.01.2021
/
Erschienen in
Kunst und Auktionen Nr. 20
Es war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der damals 22-jährige Max Clarenbach (Neuss 1880 – 1952 Köln) erstmals internationale Aufmerksamkeit fand, doch zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits im Wesentlichen die Grundzüge seiner Landschaftskonzeption entwickelt.
Jetzt weiterlesen mit 

Kostenloses Probeabo 0,00 €
Alle Artikel frei zugänglich im ersten Monat
- 4 Wochen kostenlos testen
- Danach 6,50 € pro Monat
- Monatlich kündbar

Jahresabo 4,90 €
Alle Artikel frei zugänglich pro Monat
- 4,90€ pro Monat im ersten Jahr (danach 6,50€)
- 25% Ersparnis ggü. dem Monatsabo
- Jährlich kündbar
Sie sind bereits W+ Abonnent? Hier anmelden.